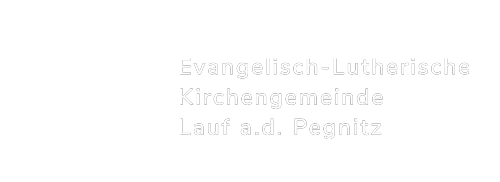Das philosophische Café – der Reader
„Wer jung ist, soll nicht zögern, sich mit der Philosophie zu beschäftigen, noch soll, wer schon ein Greis ist, in der Beschäftigung mit der Philosophie ermatten; denn niemand ist zu jung oder zu alt, für die Gesundheit seiner Seele zu sorgen. Wer nämlich sagt, die Zeit, sich mit der Philosophie zu beschäftigen, sei für ihn noch nicht gekommen oder sie sei schon vorbei, der gleicht einem Menschen, der behauptet, die Zeit glücklich zu sein, sei für ihn noch nicht da oder nicht mehr da.“
(Epikur, Brief an Menoikeus)
Die Philosophie beginnt mit dem Staunen: „ In der Tat ist der Zustand des Philosophen das Staunen (thaumazein) ; denn es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als diesen“ (Platon, Theaitetos, 155 d < zit. nach Schleicrmacher-Übersetzung>)
Aus dem Staunen wird Fragen: „Gefragt muss es gewesen sein, wenn auch nur in einem dunklen Gefühl. Nichts wirkt als Antwort, was nicht vorher gefragt geworden ist. Daher bleibt soviel Helles ungesehen, als wäre es nicht da“ (Ernst Bloch, Subjekt – Objekt, Kapitel 1)
Immanuel Kant (Logik, Akad.Ausg. Bd. 9,, S 25; KrV, B 832):
„Das Feld der Philosophie in dieser weltbürgerlichen Bedeutung lässt sich auf folgende Fragen bringen:
- Was kann ich wissen?
- Was soll ich thun?
3. Was darf ich hoffen?
- Was ist der Mensch?“ (nur in der „Logik“)
„Man kann …. niemals aber Philosophie (es sei denn historisch), sondern, was die Vernunft betrifft, höchstens nur philosophieren lernen“ (Kant, KrV, B 865; A 837)
Philosophieren heißt Rechenschaft geben („logon didonai“) (Platon z.B.: Protagoras, 336, b7– d5 ; Politikos, 285 d8 – 286 a7) < zit. nach Schleicrmacher-Übersetzung>) Es geht darum, zu überzeugen statt zu überreden
Für Platons Sokrates ist das philosophische Wissen auch ein Wissen von den eigenen Grenzen: das „wissende Nichtwissen“, das er demjenigen, der nur überreden will, voraus hat:
„Allein dieser meint alles zu wissen, obwohl er nicht weiß, ich aber, wie ich eben nicht weiß, so meine ich es auch nicht. Ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein als er, dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht glaube zu wissen“ (Platon, Apologie, 21 d, < zit. nach Schleiermacher-Übersetzung>)
Ist der philosophische Zugang zu Welt theoretisch, praktisch oder ästhetisch?
„Der Philosoph sucht den Gesamtklang der Welt in sich nachtönen zu lassen und ihn aus sich herauszustellen in Begriffen.“
Friedrich Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, Schlechta-Ausgabe, Bd. 3, 364
Oder skeptisch?
„Was ist dein Ziel in der Philosophie? – Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zu zeigen“
Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen 1, § 309
Philosophie entsteht an den Rändern unserer Erfahrungen, dort wo unsere Erklärungs-möglichkeiten und unser Verständnis an Grenzen stoßen; sie ist Ausdruck unseres zutiefst menschlichen Wissensdrangs und damit Ausdruck unserer Humanität. Philosophie ist keine elitäre Veranstaltung, sondern eine Ermutigung zu einem Gespräch, das uns hilft, uns in unserer Welt besser zurecht zu finden und unsere Möglichkeiten als Menschen und Menschheit zu erkennen und weiterzuentwickeln.
Think tank“ und „Denkfabrik“: eine Post-Postmoderne Perversion bei steigender „Unübersichtlichkeit“ der Welt. „Denkfabrikanten“ machen Gedanken zur Ware.
Denken wird „outgesourced“,„ausgelagert“, anderen (den Pferden oder Eseln?) über-lassen. In unserer spätkapitalistischen Kultur überlässt man das Denken in Politik und Wirtschaft gerne ausgesuchten „Experten“, nach dem Motto „Wo lassen Sie denken?“ Bürger und sog. „Entscheidungsträger“ stehen dadurch in der Gefahr, sich daran zu gewöhnen, vorgegebenes „Gedankengut“ unkritisch zu übernehmen und dadurch anfällig für Ideologien (politischen und ökonomischen) zu werden. Die Massenmedien tun das Ihrige hinzu.
Kant: „Habe Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ (I.Kant, „Was ist Aufklärung, Akad. Ausg. Bd. 8, S.35)
1. Crash-Kurs Philosophie
Die abendländische Philosophie beginnt bei den Griechen der Antike. Sie entwickelt sich in Abgrenzung zur Mythologie (alt-gr. „mythos“ = Rede, Erzählung, Geschichte) und zum Alltagswissen („doxa“ = Meinung). Grundlage der Philosophie ist der „logos“ (gr. „logos“ = Rede, Darstellung, Begründung)
Mit der Philosophie bzw. dem philosophischen Denken kommt etwas völlig Neues in die antike abendländische Kultur: die Vorstellung von der „Lesbarkeit der Welt“ (Hans Blumenberg; dt. Philosoph <1920 -1996>). Es ist die Annahme, dass der Erfahrungswelt mit all ihren Zufälligkeiten eine feste, erkennbare Struktur zu Grunde liegt, die von uns Menschen durch unsere(n) Verstand bzw. Vernunft erfasst werden kann.
Alltagswissen befasst sich dabei mit der Lösung technisch praktischer Fragestellungen: Wie funktioniert das? Was muss ich tun, um …… zu erreichen? Es dient der lebensweltlichen Orientierung durch allgemein geteilte „Meinungen“ ( alt-gr. „doxai“), fragt aber nicht darüber hinaus nach den Grundlagen unseres Wissens.
Mythologisches Denken (alt-gr. „mythos“ = Rede, Erzählung, Geschich-te) befasst sich mit der darüber hinausgehenden „Erklärung“ von Welt. Das mythologische Denken ist narrativ, nicht kritisierbar – nur ablehnbar – und „erklärt“ Ereignisse und Erscheinungen in der Welt animistisch als Wirkungen willkürlicher Handlungen und Kräfte (Götter, Dämonen). Die Welt ist im Ganzen „beseelt“.
Philosophisches Denken will über die Welt „Wissen“ (alt-gr. „episteme“) und nicht nur „Meinungen“ („doxai“) erzeugen. Philosophisches Denken ist diskursiv, d.h. an kritisierbaren Argumenten orientiert. Welt wird „objektiviert“.
Mythologisches Denken verbindet sich häufig mit magischen Praktiken. „Geistige“ Kräfte werden beschworen, besänftigt oder mit Ritualen ge-bannt. (Ernst Cassirer, <1874 – 1945>, dt. Philosoph, Philosophie der Symbolischen Formen, Zweiter Teil)
Philosophisches Denken, das seit der Antike, zumindest was die theore-tische Philosophie anbetrifft, Prinzipienwissenschaft und Grundlage ein-zelwissenschaftlichen Denkens sein will, entpersonalisiert die einen Teil seiner Erfahrungswelt ausmachende „Natur“ zu einer in ihren objekti-ven Strukturen beschreibbare an damit berechenbare Gegebenheit.
Auch wissenschaftliches Denken geht von der „Lesbarkeit der Welt“ als einem in sich schlüssigen „Text“ (Struktur) aus. . Dies Grundthese wird seit dem 19. Jahrhundert im Rahmen der Metaphysikkritik in Frage gestellt.
Die Rede vom „Buch der Natur“ (lat. „liber naturae“) geht zurück auf Augustinus, der es der Bibel als dem „Buch der Offenbarung“ gegenüberstellt.
Philosophie und Wissenschaft haben die Aufgabe, die Welt als „Text“ zu entziffern, womit ursprünglich die Vorstellung von der Eindeutigkeit und möglichen Vollständigkeit der Erkenntnis verbunden ist.
Nach Galilei ist das „Buch der Natur“ in der Sprache der Mathematik geschrieben, ohne die es nicht möglich sein soll, auch nur ein Wort davon zu verstehen.
Für den postmodernen Philosophen Jacques Derrida <1930 – 2004> geht daher die „Schrift“ der Sprache voraus (ders. „Grammatologie“)
Philosophie in der Antike (6. Jahrhundert vor bis Beginn des 6. Jahrhunderts nach Christus)
Philosophie war ein wesentlicher Bestandteil der griechischen wie der römischen Antike. Die in der Phase der athenischen Philosophie ab dem Ende des 5. vorchristlichen Jahrhunderts gegründeten Schulen der Sophisten und Philosophen waren integraler Bestandteil der damaligen Bildungs- und Wissensvermittlung.
Philosophen, die auch Politik und Rhetorik unterrichteten, waren – von wenigen Ausnahmen abgesehen – gesellschaftlich hoch angesehen, waren Berater und Beistände vor Gericht und ließen sich ihre Dienste meist auch gut bezahlen. In der spätrömischen Antike sorgten Philo-sophen für die politisch-sittliche Stabilisierung des römischen Kaiser-reiches.
Die Antike zeichnet sich durch eine Vielzahl philosophischer Schulen und Ansätze aus, die sich zum Teil gegenseitig heftig kritisierten.
Nach den Vorsokratikern folgen die athenische Philosophie mit den Sophisten, Sokrates, Platon und Aristoteles, danach die philosophischen Schulen des sog. „Hellenismus“, die Stoiker, die Epikureer, die akademische und die stoische Skepsis. Während der römischen Kaiserzeit bilden sich besondere Formen der Stoa und der Skepsis aus sowie der sog. Neuplatonismus des Plotin und seiner Nachfolger.
Mit dem Ende der Antike verschwindet auch die Vielfalt der Philoso-phien. Im christlichen Mittelalter bleiben im Wesentlichen der Neu-platonismus und besonders ab dem Hochmittelalter der Aristotelismus wirksam.
Philosophie im Mittelalter (6. bis Mitte des 15. Jahrhun-derts)
Seit der Spätantike wurde die Philosophie durch das sich im römischen Reich ausbreitende Christentum (dieses wurde Ende des 4. Jahrhun-derts von Kaiser Theodosius zur Staatsreligion erhoben), aber auch die theologisch werdenden Philosophie des Neuplatonismus immer mehr zu einem untergeordneten Bestandteil der Theologie. Sie wird in den „Artistenfakultäten“ der hochmittelalterlichen Universitäten zur Vorschule der Medizin, der Rechtswissenschaften und der Leitdisziplin, der Theologie.
Ihren Ausdruck fand diese Entwicklung in der Formulierung des Bischofs und Kirchenlehrers Petrus Damiani ( um 1006 – 1072), der die Philoso-phie als „ancilla theologiae“ als „Magd der Theologie“ bezeichnete.
Allerdings ist zu bemerken, dass ab dem 11. Jahrhundert mit den Theo-logen Anselm vom Canterbury, Petrus Abaelard und der Wiederent-deckung des Aristoteles durch Albertus Magnus und Thomas von Aquin im 13. Jahr-hundert sowie im 14. Jahrhundert mit Johannes Duns Scotus und Wilhelm von Ockham Personen die Szene betraten, die zwar nicht den Vorrang der Theologie in Frage stellten, die Theologie aber zunehmend „philosophisch“ hinterfragten und begründeten.
Außerdem gewannen die sog. „Artistenfakultäten“ (benannt nach den Grunddisziplinen des „septem artes liberales“, den „sieben freien Kün-sten“) immer mehr inneruniversitäre Bedeutung, da sie die Grundaus-bildung auch der Theologen übernommen und damit auch Einfluss auf die Denkweise der Studenten gewonnen hatten. Artistenlehrer wie Siger von Brabant und Boethius von Dacien gerieten dabei auch immer wieder in Konflikt mit der katholischen Kirche.
Zu den „sieben freien Künsten“ (frei hießen sie, weil sie – wie Seneca es beschreibt – „eines freien Menschen würdig sind“, der sich nicht mit Fragen der Daseinssicherung, also Erwerbsarbeit, befassen muss) zählen im Mittelalter:
Das Trivium: Grammatik, Rhetorik, Logik (Dialektik) als Grundausbil-dung (hiervor leitet sich auch unser Wort „trivial“ für „selbstverständ-lich“ im Sinne von „das weiß doch jeder“ ab)
Das Quadrivium: Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik
Vor allem die Logik, die im Mittelalter meist als Dialektik bezeichnet wird, hatte einen erheblichen Einfluss auf die theologische Lehre.
1.1. Gegenstandsbereiche der Philosophie
1.Theoretische Philosophie (von gr. „theoria“ = „Schauen“): nur an Erkenntnis interessiertes Betrachten dessen, was sich dem menschli-chen Geist, Verstand oder der Vernunft als Gegenstand darbietet. Sie erhebt den Anspruch eine Begründung von Wissen und „Wissenschaft“ zu leisten.
– Logik (Lehre von den Prinzipien des Denkens)
– Psychologie (Lehre von der Seele)
– Mathematik
– Metaphysik und Theologie
– Ontologie (Lehre vom Sein und vom Seienden als solches)
– Methodologie der Erkenntnis (z.B. Hermeneutik und
Phänomenologie)
– Wissenschafts- und Technikphilosophie
2. Praktische Philosophie (von gr. „praxis“= Handlung, Tat: Gegenstand ist das menschliche Handeln, dazu gehören die Untersuchung der Be-dingungen von Handlung, insbesondere das Problem der menschlichen Freiheit, die Fragen des guten Handelns, des gerechten Handelns sowie des richtigen Zusammenlebens von Menschen):
– Handlungstheorie, insbesondere das Freiheitsproblem
– Ethik, Grundlagen der Normentheorie und Regelbegründung
– Rechtsphilosophie, insbesondere Natur- und Menschenrechts-
– lehre
– Politischen Philosophie, Staats- und Gesellschaftstheorie
3. Ästhetik (gr. „aisthesis“ = Gefühl, Empfindung: Theorie des
menschlichen Empfindens sowie des menschlichen Ausdrucks):
– Theorie des Geschmackes, insbesondere des Schönen
– Kunsttheorie (Bildende Künste)
– Literaturtheorie, insbesondere Dramentheorie (Antike)
– Philosophie des menschlichen Ausdrucksbedürfnisses und
seiner Bedeutung (auch für die Erkenntnis; wegweisend Alexander
Gottlieb Baumgarten <1714—1762>: Ästhetik als „analogon
rationis“)
1.2. Was ist „Metaphysik“?
Nach dem Tod des Aristotles <384 – 322 v. Chr.> 322 v. Chr. gerieten dessen Schriften, die im Wesentlichen aus Vorlesungsmanuskripten bestanden zunehmend in Vergessenheit. Eine erste Ausgabe der Schriften des Aristoteles wurde erstmals von dem Peripatetiker („Peripatos“ = Schule der Aristoteles) Andronikos von Rhodos im ersten vorchristlichen Jahrhundert vorgenommen. Es wird heute angenommen, dass dieser dabei einzelne Bücher und Schriften editorisch zusammengefasst und geordnet hat.
Hierzu gehörten auch die Schriften des Aristotles, die er unter der Bezeichnung „prote philosopia“ („erste Philosophie“) verfasst und gesammelt hat.
Da Andronikos von Rhodos für die Werke zur „ersten Philosophie“, die er nach den Büchern zur Physik eingeordnet hatte, keine gebräuchliche Bezeichnung wusste, nannte er diese schlicht „nach der Physik“ oder altgriechische „ta meta ta physika“. Der Begriff „Metaphysik“ war geboren.
Metaphysik ist daher keine Lehre, die sich mit Übernatürlichem oder gar Jen-seitigem, befasst, sondern mit der Frage nach den Grundlagen der erfahrbaren und erkennbaren Welt, nach deren „Was-Sein“ („Quiditas“), aber auch nach deren „Dass-Sein“ („Quoditas“). Die Metaphysik des Aristoteles befass sich mit den allgemeinen Bestim-mungen und Eigenschaften, die Gegenständen und Ereignissen der Erfahrungswelt zukommen, wie z.B. von Substanz und Akzidenz, Beharrlichkeit und Veränderung, teleologische Prozesse, Zeitlichkeit und Dauer.
Für die genannten Problemkreis hat sich in der Folgezeit der Begriff „Metaphysik“ eingebürgert. Er steht für ein Fragen nach den Bestim-mungen, die konkrete Erscheinungen (Einzeldinge und Einzelereignisse) der Erfahrungswelt eigen und konstitutiv sind:
Beispiel: Stellen Sie sich einen roten Ball vor. Was macht diesen roten Ball als Gegenstand Ihrer Vorstellung oder Wahrnehmung aus? Was ist für sein dinghaftes So-Sein (gr. „ousia“ = Wesen) bestimmend?
Da haben Sie zunächst das „Das-da“ („tode ti“) auf das Sie verweisen oder zeigen können. Dieses „das-Da“ ist Träger („hypokeimenon“) von Bestimmungen, nämlich des „Ball-Seins“ (Art und Gattung) und des „Rot-Seins“ (akzidenzielle (zufällig hinzukommende), d.h. für den Ball nichtwesentliche Eigenschaft).
Nach der Betrachtung der Metaphysik werden Einzeldinge und Einzel-ereignisse nur als Träger allgemeiner Bestimmungen aufgefasst, die ihre Individualität in eine Fülle allgemeiner Begriffe und letztlich auflöst. Das „Individuelle“ kommt nur als „Exemplar“ in den Blick. Sein Wesen und Sein bestehen nur in Bezug auf diese.
Die Kritik der Metaphysik seit setzt hier an. Zum einen wird darauf verwiesen, dass die nur aus konkreten Individuen bestehende „Wirklich-keit“ hier zugunsten einer „Schattenwelt“ von allgemeinen Bestimmun-gen zum Verschwinden gebracht wird, der auch noch der Charakter des eigentlich Seienden zugesprochen wird (Empirismus, Positivismus). Zum anderen wird das biologische Individuum, vor allem der Mensch in seiner individuellen Situiertheit, zum Gegenpol bzw. zum Zentrum von Philosophien, die das leiblich „da-seiende“ Subjekt in den Mittelpunkt stellen (Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Derrida u.a)
Der Begriff der „Metaphysik“ wird in manchen Ansätzen der Philoso-phie des 19. und 20. Jahrhunderts kritisch bis ablehnend in dem Sinne gebraucht, dass damit die Annahme „hinter“ den Erscheinungen der Erfahrungswelt liegender Strukturen und Gestalten verstanden wird.
In der „Metaphysik“ in diesem Sinne wird die Behauptung einer all-gemein die Einzeldinge und Einzelereignisse in ihrer Wirklichkeit be-stimmende „Schattenwelt“ gesehen, die letztlich einer empirischen und damit auch „wissenschaftlichen“ Erkenntnis nicht zugänglich ist. „Metaphysische Aussagen“, wie z.B. über das „Wesen“ einer Sache, sind danach – wie Vertreter des sog. „logische Positivismus“ („Wiener Kreis“, Rudolf Carnap, Neurath und der frühe Wittgenstein) dies ausdrücken würde – daher sinnlos.
Metaphysik und (moderne) Physik
Wie bereits bei Aristoteles will die Metaphysik die Grundlagen der Wis-senschaften, auch der Physik, schaffen. Nach heutiger überwiegend positivistischer Auffassung benötigt die moderne Physik jedoch keine Begriffe, deren Referenzobjekt nicht in unmittelbarer Anschauung – in Beobachtung und Experiment – gegeben sind.
Diese Auffassung übersieht jedoch, dass Begriffe wie „Materie“, „Kraft“ und „Energie“ nie selbst „angeschaut“ werden können, sondern nur als Gegebenheit von geformten „Körpern“ und in den Wirkungen auf diese Körper. Gleiches gilt für theoretische Konstrukte wie die „Raum-Zeit“, den „Urknall“ und „Multiversen.
Auch die Analyse von Werde- und Veränderungsprozessen kommt nicht ohne Begriffe aus, die nur indirekt an Anschaulichem ausgewiesen wer-den können.
Was bedeutet esoterisch und exoterisch?
Die Begriffe „esoterisch“ und „Esoterik“ leitet sich vom alt.-gr. Wort „esoteros“ = „innerer“ ab. Als „esoterische Lehren“ wurden – vor allem bei Aristoteles – die Lehren verstanden, die im engeren Kreis der Schü-ler des „Peripatos“ (= Name der Schule des Aristoteles) vermittelt und besprochen wurden. Dabei handelte es sich jedoch nicht um „Geheim-lehren“, sondern um Lehrinhalte, deren Verständnis bereits ein gewisse Vorbildung beanspruchten oder bei denen man befürchtet, dass sie missverstanden werden könnten. (Furcht vor Asebie-Verfahren; alt-gr. „asebeia“ = Gottlosigkeit, Frevel). Ob es auch in der Akademie („Akademia“ = Name der Schule des Platon) des Platon eine esoterische Lehre gab, ist nach wie vor umstritten.
„Exoterische Lehren“ („exoteros“ = „äußerer“ bzw. „draußen“) waren dagegen die vor einem öffentlichen Publikum vorgetragenen philoso-phischen Ausführungen.
1.3. Was ist Logik?
Das Wort „Logik“ leitet sich vom altgriechischen „logos“ ab, das bereits in der Antike eine vielfältige Bedeutung hat. Die ursprünglichste ist „Rede“ im Sinne von Vortrag, Darlegung oder Ausspruch, aber auch von Gespräch und Unterredung. Es bedeutet aber auch Begründung und Rechenschaft für das, was man sagt („logon didonai“ = Rechenschaft geben). „Logos“ wird daneben in einem vom Sprecher gelösten (trans-subjektiven) Sinn gebraucht. Es bedeutet dann das Thema, die Sache oder den Stoff eines Gesprächs oder einer Geschichte. Letztlich steht „logos“ für den Vorgang der „Überlegung“, des Nachdenkens über eine Sache und letztlich für das Denken selbst.
Aristoteles war der erste Philosoph, der die sog. „Denkgesetze“ (Logik im engeren Sinne) eingehend untersucht hat.
Aristoteles Entdeckung, dass bereits formal-logische Zusammenhänge Urteile über die Wahrheit oder Falschheit von Aussagen ermöglichen, hat ihn zu umfangreichen Studien zur formalen Logik veranlasst. Man kann sagen, dass Aristoteles als erster die Grundlagen der Logik freige-legt hat.
In seinem Werk „Lehre vom Schluss“, der sog. „Ersten Analytik“ oder „Analytica priora“ (An.pr.) entwickelt er die sog. „Syllogistik“, die mindestens bis zu Gottfried Wilhelm Leibniz <geb. 1646, gest. 1716> maßgeblich war und erst im 19. Jahrhundert durch die mathematischen Logiker entscheidend verbessert wurde. Das Meiste der aristotelischen Logik ist auch heute noch nach wie vor gültig.
Die formale Logik, die allein auf Grund der Einhaltung von Denkregeln zu wahren Ergebnissen führt, was vor allem im „aristotelischen“ Hoch-mittelalter eines der Hauptgebiete der universitären Grundausbildung. Die spitzfindigen logischen Erörterungen prägten letztlich das Bild von der sog. „Scholastik“, in der die Überzeugung vorherrschte, dass der Mensch die Regeln seines Denkens mit Gott gemeinsam hat.
Der Logik, die im Mittelalter auch als „Dialektik“ bezeichnet wurde, wurde die Kraft zugesprochen, die Gedanken Gottes „nachzudenken“. Als Beispiel kann hier die sog. „lullische Kunst“ dienen, benannt nach dem Logiker und Philosophen Raimundus Lullus <um 1232 bis 1316>, der – wie später ausführlich Gottfried Wilhelm Leibniz < 1646 bis 1716> – eine sog. „ars combinatoria“ (logische Kombinatorik) und eine „ars inveniendi“ (Erfindungskunst)entwickelt hat, mit deren Hilfe durch die Anwendung logischer Gesetze alle möglichen Sachverhalte in der Welt darstellbar sein sollten.
Bis zu Georg Wilhelm Friedrich Hegels <1770 bis 1831> „Wissenschaft der Logik“ steht der Begriff der Logik einerseits für die subjektiven Denkgesetze des Menschen und andererseits für die weltgestaltenden Gedanken Gottes.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kommt es zu einer inhaltlichen Unter-scheidung des Begriffs der „Logik“. Einerseits entwickelt sich die strenge formale und mathematische Logik, die sich mit den formali-sierten Beziehungen von Aussagen und ihren Wahrheitswerten befasst. Hierzu gehört auch das Programm einer Begründung der Mathematik durch formale Logik, wie sie Gottlob Frege <1848 – 1925> und Bertrand Russell < 1872 – 1970> versucht haben. Andererseits wird die Logik ein Gegenstand der empirischen und philosophischen Psychologie. Insbe-sondere im Neukantianismus, der Phänomenologie und der Kulturphilo-sophie wird die Logik unter dem Gesichtspunkt einer materialen Kon-stitutionstheorie behandelt. Nach welchen „logischen Gesetzen“ baut der Mensch seine „Lebenswelt“ auf.
Es handelt sich hierbei um eine „Logik der Sachen“, also um Fragen der sachlichen Beziehungen der Dinge der erfahrbaren Welt, soweit es sich um notwendige und nicht nur um zufällige Beziehungen handelt (mate-riale Logik).
Sowohl die empirische Psychologie des 19. Jahrhunderts (insbesondere Wilhelm Wundt u.a, Assoziations- und Gestaltpsychologie) als auch die philosophische „Konkurrenzdisziplin“ der Phänomenologie (Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, Wilhelm Szilasi, Alfred Schütz u.a) suchen nach der inneren „Logik“ der Erfahrungswelt, die sich als im Wesentlichen regelhaft und nicht nur als Anhäufung zusammenhang-loser Zufälle darstellt. Auch Gottlob Frege sieht die formale Logik als spezifisch philosophische Disziplin in Konkurrenz zur empirischen Dis-ziplin und Kognitionswissenschaft. (Logik geht der Erfahrungsbildung immer schon voraus und kann daher nicht Gegenstand einer Erfahrungs-wissenschaft sein. „petitio principii“)
Logik und „Dialektik“
Der Begriff der „Dialektik“ wird durch Platon und den platonischen Sokrates in die Philosophie eingeführt. Das Wort leitet sich her vom altgriechischen „dialegein“ = sich unterhalten, etwas besprechen, diskutieren. Dialektik ist nach Platon die Kunst, im Gespräch über eine Sache und ein Problem solange alle Aspekte zu beleuchten, bis diese weitestgehend oder vollständig erkannt ist.
Dialektik steht daher bei Platon auch für die einzige Methode, durch die die „Ideen“ erkannt werden können. Durch die Dialektik wird die Sache selbst erkannt, indem man von einem zunächst alltäglichen Be-griff (z.B. der allgemeinen Meinung darüber) durch gemeinsame Überlegung zu einem immer komplexeren und damit auch sachan-gemesseneren Begriff fortschreitet.
Aristoteles verwendet die Unterscheidung der Begriffe von Logik und Dialektik zur Kennzeichnung der Untersuchung der notwendigen Schlüsse und „Wahrheiten“ (Logik) von den „nur wahrscheinlichen“ (Dialektik, dargestellt in der „Topik“). Die aristotelische „Dialektik“ stellt eine Theorie der vernünftige Argumentation angesichts einer unklaren Sachlage dar.
Die Begriffe Logik und Dialektik werden im Hochmittelalter (Scholastik) synonym gebraucht. Sie dienen als Oberbegriffe für eine Argumenta-tionstheorie, die die Grundlagen und den Verlauf eines vernünftigen Gesprächs beinhaltet. Die oft spitzfindigen Argumentationen in da-maligen Gesprächen werden auch heute noch als „scholastisch“ bezeichnet.
Der Begriff der „Dialektik“ bekam durch G.W.F. Hegel <1770-1831> und den Hegelianer Karl Marx <1818-1883> im 19. Jahrhundert eine neue Bedeutung, die allerdings an den platoni-schen Begriff der Dialektik anknüpft. Als Dialektik wird danach die Darstellung „Eigenbewegung des Begriffs“ bezeichnet.
Ausgangspunkt der so verstandenen „Dialektik“ ist zunächst ein ein-facher Begriff, wie z.B. der des „Seins“. Die Erkenntnis, dass Begriffe, wie der des „Seins“, nur dann bestimmt werden können, wenn sie von anderen Begriffen unterscheidbar sind, führt zu der Auffassung, dass „Begriff“ und „Gegenbegriff“ (hier Nicht-Sein oder Nichts) sich nur wechselseitig definieren können. „Begriff“ und „Gegenbegriff“ bein-halten sich wechselseitig und sind dadurch „vermittelt“. Die „Vermitt-lung“ beinhaltet dabei die Begriffe „Werden und Vergehen“ (aus Nichts wird Sein und aus Sein wird Nichts)
Dialektik wird hierbei unter dem formalen Aspekt von Thesis, Antithesis und Synthesis (Vermittlung) gedacht. Hegel verwendet für diese Be-griffsentwicklung, die an Anreicherung des ursprünglichen Begriffes verstanden wird – in den Begriffen Werden und Vergehen sind notwen-dig die des Seins und Nicht-Seins mitgedacht – das Wort „Aufhebung“.
Das deutsche Wort „aufheben“ hat dabei die dreifache Bedeutung von „verwahren“, „beseitigen“ und „in die Höhe heben“.
Für Hegel stellt sich in der Dialektik der Begriffe, das Zu-sich-selbst-kommen des Geistes (Gottes) als Selbstobjektivierung dar, für Marx die Entfaltung der „Materie“ (dialektischer Materialismus) in der Geschich-te der Menschheit (historischer Materialismus)
1.4. Was ist Erkenntnis (-theorie)?
Der Begriff „Erkenntnistheorie“ wurde durch die Denker der neukantia-nischen „Marburger Schule“ (Hermann Cohen <1842 – 1918>, Paul Natorp <1854 – 1924> u.a.) in die Philosophie eingeführt. „Erkenntnis-theorie“ im Sinne des Neukantia-nismus befasst sich mit der Begrün-dung und Kritik der allgemein verbindlichen Geltung von Wissen und Wissenschaft.
Der Sache nach betrifft die Suche nach der Begründung von Wissen als Bestand „wahrer“ Aussagen über die Welt eine der Hauptgegenstände der Philosophie. Als solche ist sie bereits seit der Antike einer der Hauptgegenstände der Philosophie.
Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts sind die gegebenen Antworten an der im folgenden dargestellten „natürlichen Einstellung“ der Menschen dazu orientiert:
Erkenntnisquellen: Sinne Vernunft/Verstand
Erkennende(r) Erkanntes
Subjekt Objekt
Bewusstsein Realität
Urteil Tatsache
Geist Welt
Die Reihe orientiert sich an der Folge von Einem zum Vielen. Das erken-nende Subjekt steht dem erkannten Objekt als Einheit gegenüber. Das Bewusstsein hat eine Vielzahl von Vorstellungen über eine mannigfalti-ge Erfahrungswelt. Das Urteil fasst mehrere Vorstellungen zu einer Tat-sache zusammen. Der Geist repräsentiert die Gesamtheit der Vorstel-lungen und Ideen, die Welt die Gesamtheit aller Tatsachen.
Die Quellen der Erkenntnis sind die Sinne („aisthesis“), die dem Erkennenden Daten von der zu erkennenden „Außenwelt“ gibt, und der Verstand bzw. die Vernunft („logos“, „nous“), die die Sinnesdaten aufordnen.
Erkenntnisquellen: Erscheinung oder „an sich“ ?
Erkennende(r) Sinnlichkeit und Sinne Erkanntes
Subjekt Wahrnehmung Objekt
Bewusstsein Einbildungskraft Realität
Urteil Verstand Tatsache
Geist Vernunft Welt
Frage: wie können „erkennendes“ Subjekt und „erkanntes“ Objekt zueinander finden? Greift das Subjekt auf das Objekt zu und verändert oder erschafft es das Objekt dadurch durch seine aktiven logischen Leistungen? Oder wird das Objekt in seiner eigenen Strukturiertheit („an sich“) dem Subjekt „gegeben“, d.h. drückt es sich wie ein Stempel in heißes Wachs dem erkennenden Subjekt auf?
Erkenntnisquellen: „an sich“ ?
Erkennende(r) Sinnlichkeit und Sinne prägt S O Erkanntes
Subjekt Wahrnehmung oder prägt Objekt
Bewusstsein Einbildungskraft O S oder Realität
Urteil Verstand bedarf es der Tatsache
Geist Vernunft Vermittlung? Welt
Nach der kantischen Transzendentalphilosophie ergibt sich folgendes Bild:
Erkennende(r) Erkanntes ≠ Ding
Subjekt Objekt ≠ an
Bewusstsein Realität (Erscheinung) ≠ sich
Urteil Tatsache ≠
Geist Welt ≠
Mit der Entdeckung der Bedeutung der Sprache und (kultureller) Symbole (Semiotik) tritt zwischen die subjektiven Erkenntnisvermögen und das Objekt eine inter- bzw. transsubjektive Instanz, die das Objekt repräsentiert:
Erkennende(r) Sprache, Erkanntes
Subjekt (kult.) Symbol Objekt
Bewusstsein Realität
Urteil Tatsache
Geist Welt
In der neueren Philosophie findet zudem ein sog. „medialer Ansatz“ wieder zu-nehmendes Interesse. Erkenntnis ist danach vermittelt durch ein „Medium“, in dem sich und durch das sich erkennendes Subjekt und erkanntes Objekt erst gegenübertreten können. In der Tradition finden sich dazu die platonischen Ideen und der göttliche „logos“ bzw. Gott.
In der neuzeitlichen Philosophie finden sich „mediale Ansätze“ in der Sprachspieltheorie Ludwig Wittgenstein II, den strukturfunktionalisti-schen Theorien Michel Foucaults, in der Theorie der „Lebenswelt“ des späten Edmund Husserl sowie in der modernen Hermeneutik.
Medium: Ideen, Gott, Lebenswelt, Struktur, System, Sinn – Horizont
Erkennende(r) Erkanntes
Subjekt Objekt
Bewusstsein Realität
Urteil Tatsache
Geist und Welt werden durch das Medium ersetzt.
Verstanden? Nein? Dann beantworten Sie bitte folgende Frage: Was ist ein Tennisspiel?
Zwei oder vier Menschen spielen auf einer ebenen Fläche mit einem Ball, den sie mit Hilfe eines Schlägers in Richtung des Spielgegners bewegen. Das ist der beobachtbare Vorgang. Ist das schon ein Tennisspiel?
Notwendig für ein „Tennisspiel“ ist ein Spielfeld mit einer gewissen Größe, optisch erkennbarer Einteilungen des Spielfeldes, ein Netz in der Spielfeldmitte und Spielregeln, die festlegen, wie das Hin- und Herspielen eines bestimmten Balles mit einem bestimmten Schläger stattzufinden hat. Spielfeld, Regeln etc. sind noch kein Tennisspiel, aber sie legen den Rahmen fest, in dem das Spiel stattfindet.
Verstanden! Medien legen die Bedingungen und Regeln für die „Repräsentanz“ von Objekten im Rahmen der „subjektiven“ Erkenntnis fest. Um bei unserem Beispiel zu bleiben, welche Spielablauf ein Ten-nisspiel nimmt, ist medial völlig offen. Wer wie aufschlägt, retourniert etc. ist Ergebnis eines offenen Spielverlaufes. So ist es auch mit den Erkenntnissen. Welche inhaltlichen Erkenntnisse gewonnen werden, ist durch das Medium nicht festgelegt, aber der Rahmen, in dem sie sich zeigen können.
Medien bleiben dabei in der Regel „unthematisch“ und steuern doch den Erkenntnisprozess und die subjektive Auffassung von „der Welt“. Nur in Krisen werden Medien thematisch, wie bei einem Streit, ob beim Tennis der Ball ins „Aus“ gegangen ist.
In der Antike (600 v.Chr. bis 550 n.Chr.) ist „Erkenntnis“ das Begreifen des Wesens („ousia“) der Dinge, der Ordnung hinter den zufälligen Erscheinungen („phainomena“). Der Mensch ist dazu in der Lage, durch den „logos“ aktiv in diesem Sinne „wahre“ Erkenntnisse zu gewinnen und als allgemein gültiges Wissen („episteme“) zu begründen.
Im frühen christlichen Mittelalter (550 bis 1000 n.Chr.) tritt im An-schluss an Augustinus an die Stelle des aktiv gewonnen und begründ-baren „Wissens“ die „Offenbarung“ durch Gott, die dem Menschen Erkenntnisse über das Heilsgeschehen und die Welt nur passiv rezeptiv zugänglich macht. Ab dem 11. Jahrhundert werden – insbesondere in der Folge der Rezeption der aristotelischen Logik und Metaphysik – Glaubenslehren durch Theologen kritisch hinterfragt. Die Offenbarung durch den göttlichen Geist wird dabei zwar nicht in Frage gestellt, Erkenntnisse können aber aktiv gesucht und gefunden werden, da der göttliche Geist den ihm ähnlichen menschlichen Verstand dazu be-fähigt.
In der frühen Neuzeit (Renaissance und Frühaufklärung: 1450 bis 1600 n.Chr.) beginnt sich der Mensch als eigenständig erkenntnisfähig zu erfahren. An die Stelle einer göttlich offenbarten Welt tritt ein na-turalistisches Weltbild, das aus der Perspektive des Menschen als Be-trachter aufgefasst wird.
In der empiristischen und rationalistischen Aufklärung wird „Erkennt-nis“ als Leistung des wahrnehmenden und denkenden Subjekt verstan-den. Erkenntnisse werden aus Sinnesdaten und kognitiven Ordnungs-funktionen gewonnen und sind stets auf das erkennende Subjekt bezo-gen. In der radikalsten Form des sensualis-tischen Idealismus des irischen Philosophen und Bischofs von Cloyne, George Berkeley <1685 – 1753>, wird das „Sein“, die Wirklichkeit der Objekte mit deren sub-jektiven Wahrnehmung gleichgesetzt („esse est percipi“ = „Sein ist Wahrgenommen-werden“)
Mit der sog. Transzendentalphilosophie Kants vollzieht sich die sog. „kopernikanische Wende“ der Philosophie. Bisher wurde unter „Er-kenntnis“ die zutreffende Auffassung der an sich strukturierten und gestalteten Objekte verstanden. Bei aller Aktivität des Subjekts im Rahmen des Erkenntnisvorganges lag eine wahre Erkenntnis nur dann vor, wenn das unabhängig vom erkennenden Subjekt existierende Objekt durch den Verstand zutreffend abgebildet wurde.
Kant schreibt in der Vorrede zur zweiten Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ von 1787:
„Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Ge-genständen richten. Aber alle Versuche, über sie etwas a priori auszu-machen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde gingen unter dieser Voraussetzung zu nichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit der Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiermit ebenso, als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt…..“ (Kant, Akad.Ausg., III, 12; XVI)
„Transzendental“ steht bei Kant zur Kennzeichnung der apriorischen, d.h. nicht aus der sinnlichen Wahrnehmung und Erfahrungsbildung herleitbarer kognitiven Grundstrukturen des Verstandes (Formen der Anschauung = Raum und Zeit sowie die sog. Kategorien der Quantität = Zahl und Größe; Qualität = Beschaffenheit; Relation = Substanz und Akzidens, Kausalität und Korrelation; und Modalität = Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit). Die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrungsbildung wird bei Kant zur Bedingung der Möglichkeit der Gegen-stände der Erfahrung selbst. In anderer Weise können uns Gegenstände der Erfahrung nie begegnen.
Nach Kants sog. „Konstitutionstheorie“ werden alle Objekte möglicher Erfahrung durch den apriorischen, d.h. jeder Erfahrung vorhergehen-den, subjektiven menschlichen Erkenntnisapparat gestaltet und be-griffen. Was oder wie die Objekt „an sich selbst“ sind, kann von uns Menschen nicht erkannt werden. Kant nennt dies das „Ding an sich“ oder das „x ignotum“ ( „Das unbekannte x“).
In der nachkantischen Philosophie ist dieser Gedanke, dass die Gegen-stände der Erfahrung durch unseren Erkenntnisapparat „konstituiert“ oder „konstruiert“ werden, in die unterschiedlichsten philosophischen Strömungen eingeflossen. Auch wenn die dahinterstehende „Bewusst-seins-„ bzw. „Reflexionsphilosophie“ dabei zum Teil abgelehnt wurde, blieb das Verständnis dafür erhalten, dass Erkenntnis an die spezifisch menschlichen Bedingungen der Erfahrung, seien sie nun kognitiv, sprachlich oder pragmatisch, gebunden ist.
Abgesehen von streng materialistischen bzw. realistischen Positionen gehen die meisten philosophischen Richtungen des 20. Jahrhunderts davon aus, dass die „Erkenntnis von Welt“ in irgend einer Weise eine zumindest mitwirkende Leistung des Subjekts voraussetzt.
Der erkenntnislogische Realismus oder Naturalismus setzt die Annahme voraus, dass das Objekt der Erkenntnis in sich vollständig strukturiert und gestaltet ist und das erkennende Subjekt Mensch rein passiv re-zeptiv dessen Strukturen und Gestalten vermittelt durch seine Sinne „wahrnimmt“. Bereits im Begriff „wahr-nehmen“ zeigt sich jedoch eine Leistung des Subjekts an, durch die sinnliche Eindrücke auf ihren zutreffenden „Sachgehalt“ geprüft werden. Jeder sinnliche Eindruck, jede „Wahrnehmung“ ist bereits auf eine kritische Prüfung durch den Verstand bezogen, der Phantasiebilder und Sinnestäuschungen von sachgemäßen „Wahrnehmungen“ zu unterscheiden erlaubt.
Demgegenüber geht die Mehrzahl der philosophischen Ansätze der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts und des 20. Jahrhunderts davon aus, dass dem erkennenden Subjekt im Vorgang der „Erkenntnis“ eine aktive Rolle zukommt.
Arten der Erkenntnis:
– intuitive Erkenntnis: Unmittelbares Einsehen durch „Evidenz“. Die Erkenntnis „leuchtet unmittelbar ein“. Evidenzen sind dabei sowohl bei unmittelbar anschaulichen Gegebenheiten (Phänomenologie) als auch bei einfachen mathematischen und logischen Operationen möglich.
– diskursive (symbolisch -sprachliche) Erkenntnis: die Einsicht setzt eine Begründung bzw. Rechtfertigung durch Argumente voraus. Die Argumen-tationskette besteht dabei aus einer Folge von auf „Einsichten“ beru-henden Aussagen bzw. Behauptungen, die formal-logisch korrekt ver-knüpft sind. Bei unanschaulichen, abstrakten Gegenständen (wissen-schaftliche Theoriebildung, Ethik, Rechtstheorie etc.) tritt an die Stelle der „Einsicht“ die Korrektheit der Methode der Erkenntnisbildung.
Formen der Erkenntnis
– analytisch-zergliedernd: Erklären (Warum kommt kein Wasser aus dem Gartenschlauch?)
– holistisch-hermeneutisch: Verstehen (Was ist die Natur? Was ist der Mensch? Warum ist etwas und nicht vielmehr nichts?)
– systemtheoretisch: Verbindung von Kausalität und Finalität (Funktionalismus, Kybernetik, Autopoesie (gr. „autopoesis“ – Selbstherstellung))
1.5. Die Unterscheidung von Empirismus und Rationalismus
Die Unterscheidung von Empirismus und Rationalismus wird erst im Gefolge von Kant ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts in der Philoso-phie allgemein gebräuchlich. Erstmals Erwähnung findet sie jedoch bereits bei Francis Bacon < 1551 – 1626 >
In der Antike wird die Unterscheidung nur bezüglich der Einteilung der Medizin in „medicina rationalis“, d.h. theoretische, und „medicina empirica“, d.h. praktische Medizin gebraucht. Als „Empiricus“ wurde damals ein praktisch tätiger Arzt bezeichnet. So ist aus dem Namen des skeptischen Philosophen Sextus Empiricus abzuleiten, dass dieser praktischer Arzt war.
Die Ausarbeitung der beiden Positionen erfolgt vom 16. bis ins 18. Jahrhundert, wobei sich der Empirismus hauptsächlich aus der briti-schen Insel entwickelt und der Rationalismus im kontinentaleuro-päischen Bereich.
Im 19. Jahrhundert hat der britische Philosoph John Stuart Mill <1806 -1873> unter dem Aspekt der wissenschaftlichen Methodenbildung weiterentwickelt. Der Sache nach wird der Empirismus vom sog. „Positivismus“ (Auguste Comte <1798 – 1857>) abgelöst, der die Erkenntnisbildung ebenfalls von dem sinnlich wahrnehmbaren Gegebenen ausgehen lässt.
Nach dem Ende des sog. „Deutschen Idealismus“ (Fichte, Schelling, Hegel; ca. ab 1840) werden rationalistische Ansätze noch im sog. „Neukantianismus“ und der Phänomenologie vertreten, in letzterem jedoch stark geprägt durch den Positivismus ( E. Husserl: „Zu den Sachen selbst“)
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchen die Vertreter des sog. „logi-schen Empirismus“ bzw. „logischen Positivismus“ (Ludwig Wittgenstein I, „Wiener Kreis“, Ernst Mach, Rudolf Carnap, Otto Neurath, Moritz Schlick) auf empiristischer Grundlage eine Idealsprache zu entwickeln, mit deren Hilfe eine Abbildung des Sachzusammenhanges der Erfah-rungswelt durch eindeutig bestimmte Begriffe gewährleistet werden sollte. Das Programm entsprach dem der sog. „analytischen Philoso-phie“ (Gottlob Frege, Bertrand Russell, Alfred Tarski, Williard van Orman Quine, Gilbert Ryle, Saul A. Kripke; Hilary Putnam).
Die Vertreter des sog. „kritische Rationalismus“ (Karl Raimund Popper, Hans Albert) sehen dieses Programm als undurchführbar an. Die Erfah-rungsbildung, zumal in den Wissenschaften, erfolgt nämlich dadurch, dass Theorien und Hypothesen als vorausgehende Gedanken in der Erfahrung überprüft werden.
Nach der Auffassung der „kritischen Rationalisten“ können Theorien und Hypothesen als Grundlagen der Wissensbildung in der konkreten Erfahrung (Beobachtung oder Experiment) aber nur bestätigt und nicht – auch im empiristischen Sinn – als „wahr“ erwiesen werden, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese durch die nächste Beobachtung oder das nächste Experiment widerlegt werden.
Die „kritischen Rationalisten“ haben sich dadurch von der Suche der Rationalisten Rene Descartes, Baruch de Spinoza und Gottfried Wilhelm Leibniz nach Gewissheit verabschiedet. Wissen und Erkenntnis sind da-nach grundsätzlich „fallibel“ (lat. „fallibilis“ = „trügerisch“, „irrtums-anfällig“). Statt „Wahrheit“ kann nur eine mehr oder weniger häufige „Bestätigung“ erreicht werden. (sog. „Fallibilismus“)
Was versteht man unter Empirismus und Rationalismus?
1.5.1. Empirismus
Als Empirismus wird die erkenntnistheoretische Auffassung bezeichnet, wonach alle Erkenntnis von in der Erfahrung begegnenden Einzelgegen-ständen und Einzelereig-nissen aus geht. Das Wort leitet sich vom alt-griechischen Wort „empeiria“ = „Erfahrung“, „Kenntnis“ ab.
Der Empirismus geht auf Aristoteles < 384 – 322 v.Chr.> zurück, für den alles Wissen und alle Wissenschaft in die Einzelwahrnehmung bzw. Beobachtung (in den Sinnen) beginnt.(S. Aristoteles, An.post., Zweites Buch, Kapitel 19).
Aufgabe des Denkens ist es, aus der konkreten sinnlichen Wahrnehmung oder Vorstellung den Gegenstand einer möglichen Erkenntnis zu machen, indem sie dessen überindividuelle Merkmale herausstellt:
„Denn man nimmt das Einzelne wahr, aber die Wahrnehmung geht auf einen allgemeinen Gegenstand“ (An.post., Zweites Buch, 19. Kapitel, 100a, 20 f)
Dieser Ansatz wurde seit dem 16. Jahrhundert vor allem von angelsäch-sischen Philosophen weiterentwickelt, so dass oft auch von „britischen Empirismus“ gesprochen wird. Hauptvertreter sind Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, Gorge Berkeley, David Hume und John Stuart Mill.
– Francis Bacon < 1551 – 1626 > : Entwicklung der empirischen Methode durch Beobachtung und Experiment (“De nova Atlantis“ und „Novum Organon“)
– Thomas Hobbes < 1588 – 1679 > und John Locke < 1632 – 1707> : philosophi-sche Begründung des Empirismus in Auseinandersetzung mit dem Rationalisten Ren Descartes. Locke: Verstand ist ein „leeres Kabinett“ („tabula rasa“), aber „ideas of reflection“ entstehen durch „innere Wahrnehmung“
George Berkeley < 1685 – 1753 > und David Hume < 1711 – 1776 > : Darlegung der idealistischen und skeptischen Konsequenzen eines strikten Empirismus
John Stuart Mill < 1806 – 1873 >: Logische Begründung der induktiven Methode
Die Erfahrungsbildung beginnt mit einfachen Wahrnehmungen und Be-obachtungen, die – soweit möglich – in Experimenten unter kontrollier-ten Bedingungen wiederholt werden. (Vermögen der Sinne)
Bei den beobachtbaren Einzelgegenständen und Einzelereignissen wird nach Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten gesucht, und diese danach in allgemeine Klassen zusammengefasst (Methode der Abstraktion oder Induktion). (Vermögen des Verstandes).
Hierdurch werden allgemeine Vorstellungen und Begriffe gebildet, die jedoch nur im Verstand vorhanden sind und keine Eigenschaften der Gegenstände und Ereignisse selbst darstellen (sog. Nominalismus; anders noch Aristoteles)
Der Empirismus entspricht am ehesten unserer natürlichen Auffassung von Erkenntnisbildung und wird – allerdings meist in der Form eines ontologischen Realismus – in den sog. Naturwissenschaften vertreten.
In der Philosophie begegnet der strenge Empirismus folgenden Bedenken:
Wenn Wahrnehmungen (Sinnesdaten) ontogenetisch auf einen „leeren“ Verstand treffen, wie entstehen dessen Fähigkeiten zur Ordnung der Sinnesdaten durch Abstraktion? (Was bedeutet „innere Wahrnehmung“ bei Locke?)
Wenn alle Erkenntnis nur auf der Wahrnehmung von Sinnesdaten be-ruht, die im Verstand „Ideen“ verursachen, was wissen wir dann von den Dingen selbst?
Wie kann man durch Induktion zu allgemeingültigen Aussagen kommen?
2. Rationalismus
Unter Rationalismus wird die erkenntnistheoretische Auffassung ver-standen, wonach die Erkenntnis der Gegenstände und Ereignisse der Erfahrungswelt durch apriorische Eigenschaften und Funktionen des Verstandes ermöglicht wird. Der Begriff leitet sich vom lat. Wort „ratio“ = „Vernunft“, „Überlegung“, „Begründung“, „Grund“ ab.
Die antiken Vorläufer des Rationalismus ab dem 16. Jahrhundert finden sich in der Ideenlehre des Platon sowie im „logos“- Begriff der Stoiker. Die Erkenntnis eines Einzelgegenstandes bzw. Einzelereignisses ist nur möglich als Exemplar eines Allgemeinen, das sich nur im Verstand (Idee, logos) finden kann.
Hauptvertreter des kontinentaleuropäischen Rationalismus ab dem 17. Jahrhundert sind Rene Descartes, Baruch de Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz und die deutsche „Schulphilosophie“ um Christian Wolff <1679 – 1754>
Im Zusammenhang mit dem Rationalismus stehen auch die Begriffe „Bewusstseinsphilosophie“ oder „Reflexionsphilosophie“. Hierunter wird verstanden, dass das Denken und Vorstellen sich selbst hinsichtlich seiner Voraussetzungen und Bedingungen zum Gegenstand nimmt, sich gewissermaßen auf sich selbst zurückbeugt (lat. „reflectere“ = „zurück-beugen“, „zurückwenden“). Als Bewusstseins- bzw. Reflexionsphiloso-phien werden insbesondere die Philosophie Rene Descartes, Immanuel Kants, Johann Gottlieb Fichtes, G.W.F. Hegels und Teile der Philosophie Edmund Husserls (transzendentale Phänomenologie) bezeichnet.
Dem Rationalismus eigentümlich ist die Vorstellung der Gleichursprüng-lichkeit von Denken und Sein, sei es vermittelt über „Gott“ als „All-Einem“, der als Garant der Richtigkeit des Denkens fungiert wie bei Descartes, als Identität von Geist und Materie (Natur) im Pantheismus Spinozas, in der „prästabilierten Harmonie“ Leibniz´ und letztlich in der Identitätsphilosophie Schellings.
Auch Rationalisten gehen davon aus, dass es ein außerkognitives, außermentales Sein gibt. Dieses ist jedoch nur dadurch erkennbar, dass es durch apriorisch vorhandene Strukturen des Denkens oder des Geistes „geformt“ wird. Die Formprinzipien (alt-gr. „idea“; „ideae innatae“) werden im Rationalismus durch den Verstand an die Sinnes-daten herangetragen. Im Gegensatz dazu gehen Empiristen davon aus, dass bereits die erkennbare Erfahrungswelt an sich gestalthaft ist und sich diese Gestalt dem Verstand einprägt.
Nach Rene Descartes und Gottfried Wilhelm Leibniz sind diese Ideen sog. „Vernunftwahrheiten“, die durch keine Erfahrung widerlegt werden können. (z.B. Satz des Widerspruches <„entweder a oder nicht a“> oder Satz des Grundes <„aus nichts wird nichts“ oder „nichts entsteht ohne Grund“ „nil fit sine ratione“)
Das Problem des „zureichenden Grundes“ (Kausalprinzip als Grundlage der sog. Naturwissenschaften) wird Kant zu der Formulierung seiner „Transzendentalphilosophie“ veranlassen, durch die er Empirismus und Rationalismus zu versöhnen versucht.
Empiristen und Rationalisten sind in vielen Punkten ihrer Philosophien nicht so weit entfernt, wie es die Gegenüberstellung vermuten lässt. Auch für Rationalisten ist eine Tatsachenerkenntnis nicht ohne Sinnes-daten und Wahrnehmung möglich.
1.6 Was ist „Ontologie“?
Das Wort „Ontologie“ ist erst im 16. Jahrhundert entstanden. Es leitet sich vom griechischen „to on“ „das Sein“ ab und findet sich erstmals in der sog. Schulphilosophie des 16. und 17. Jahrhunderts sowie bei Gottfried Wilhelm Leibniz.
Auch die Wortwurzel „ontos“ = „wahrhaft“, „wirklich“, „in Wahrheit“ als Begriff für die Frage nach dem „wahrhaft Seiendem“ kommt in Betracht. Seit Beginn des philosophischen Denkens wurde nämlich das „Sein“ dem „Schein“ entgegengesetzt. Bereits in der vorsokratischen Philosophie findet sich die Unterscheidung von „Sein“ und „Schein“ (bloße, möglicherweise trügerische Erscheinung). In der „Ontologie“ werden daher die Fragen gestellt, was das „Sein“ selbst ausmacht („quoditas“ = das „Dass-Sein“) und wie das Seiende verfasst ist („quiditas“ = das „Wie-Sein“)
Der Sache nach findet sich die Ontologie bereits in der Metaphysik des Aristoteles, wobei diese dort mit der Theologie verbunden ist. Die im 17. Jh. grundgelegte Trennung der natürlichen Theologie von der „Ontologie“ vollendet sich bei Chr. Wolff <1679–1754>, und zwar exemplarisch in seinem lateinischen Werk „Ontologia seu philosophia prima est scientia entis in genere seu quatenus ens est“ („Die Ontologie oder Erste Philosophie ist die Wissenschaft vom Seienden im Allgemei-nen bzw. sofern es Seiendes ist“).
Kant kritisiert das Vorhaben der so verstandenen „Ontologie als „an-maßend“, weil sie vorgibt die „Dinge an sich selbst“ in ihrer Struktur und Sosein darzustellen. Nach Kants „Transzendentalphilosophie“ lassen sich dagegen nur die Verstandesbegriffe, die die Erscheinungen konstituieren und strukturieren, darstellen. Hegels Philosophie des sich objektivierenden Geistes begreift die Ontologie im Anschluss daran als „Wesenslehre der unmittelbar gegebenen Gegenstände“. In dieser Weise versteht auch Edmund Husserl den Gegenstand seiner Phänome-nologie („Zu den Sachen selbst“) als Suche nach den Konstitutionsbe-dingungen des Seienden als Gegebenen.
Die „Ontologie“ wird meist als Unterdisziplin der „Metaphysik“ an-gesehen, die daneben auch die Erkenntnistheorie – Beziehung von erkennendem Subjekt und erkanntem Objekt – mit beinhaltet.
Eine Frage der Ontologie ist auch das Verhältnis von Essenz (Wesen) und Existenz (Dasein). Zunächst betrifft die Essenz das „Was-Sein“ einer Sache und die Existenz ihr „Dass-Sein“. Das Wesen einer Sache wird durch Allgemeinbegriffe (Prädikate) ausgesagt, die Existenz durch eine deiktische (hinweisende) Aussage ohne Prädikate:
„Hans ist ein Mann, 45 Jahre alt und Lehrer“ (kann auch eine nur gedankliche Vorstellung betreffen; z.B. in einem Roman): Wesensaussage
„Das da ist Hans“: Existenzaussage (Heidegger: Dasein = In-der-Welt-Sein)
Husserl sieht die Ontologie als Wesenswissenschaft und damit als Teil einer objektiven, materialen Logik. Ontologie ist an der Frage des „Was-Seins“ orientiert.
Sein Schüler Heidegger dagegen entwirft in seinem Werk „Sein und Zeit“ eine „Fundamentalontologie“, worunter er bereits dort eine Analyse des Daseins als „In-der-Welt-Sein“ versteht. Die Blickrichtung wendet sich vom „Was-Sein“ zum „Dass-Sein“, zu einem Sein, dass sich selbst als existierend verstehen kann. Sie ist insoweit nicht mehr logisch, sondern hermeneutisch fundiert.
Nach J.-P. Sartre geht – Heidegger folgend – die „existentia“ des Menschen der „essentia“ voraus. Heidegger grenzt sich aber in seiner späteren Philosophie entschieden gegen Sarte´s Verständnis des Seins als konkret menschliches Hier- und Jetzt sein ab. Er wirft Sartre vor, damit im Denken der Subjekt-Metaphysik zu verbleiben. Heidegger verwendet deswegen in seiner späten Philosophie den Begriff der „Ek-sistenz“, um sich von Sartre´s Philosophie des „Existenzialismus als Humanismus“ zu unterscheiden.
Heidegger betont die „Differenz von Seiendem und Sein“. „Sein“ ist zwar „jeweils das Sein eines Seienden“ (Heidegger SuZ, 9), es ist aber „nicht so etwas wie Seiendes“ (aaO, 4). Nach Heidegger verfehlt die Metaphysik mit der „Frage nach dem Ding“ (dem Seienden) die eigentliche Frage der Philosophie: nach dem Sinn von „Sein“.
Während Heidegger in „Sein und Zeit“ (SuZ) noch aus der Selbstver-ständigung des menschlichen „Daseins“ als „In-der-Welt-Sein“ er-schließen will, kann dessen hermeneutische Ontologie der späteren Jahre nur auf den „Zuspruch des Seins“ in der Dichtung als besondere menschliche Art des Weltverhaltens „warten“. Heideggers Spätphiloso-phie steht unter dem Wort der „Gelassenheit“, worunter er die auf den Zuspruch des Seins bezogene Haltung versteht.
Heidegger, der hier in seiner Spätphilosophie der Mystik Plotins nahe- steht, hat durch diese Gedanken die Philosophie der Postmoderne, insbesondere Lyotard und Derrida entscheidend beeinflusst.
Die metaphysik- und vernunftkritische „Postmoderne“ setzt der Ratio-nalität des neuzeitlichen logisch-technologischen Denkens mit seinem Vorrang des Allgemeinen, das „Sein“ des partikularen Individuums entgegen, das sich nur in seiner Differenz gegenüber dem Anderen zur Geltung bringen kann. Die Philosophie der Postmoderne ist der Versuch, das Singulare, das Einzelne, das „Dass-Sein“ ohne alle allgemeinen Bestimmungen zur Sprache zu bringen.
Bei Lyotard geschieht dies durch den Rückgriff auf den Widerstreit und das Ästhetische, bei Derrida durch die „Dekonstruktion“ der „Schrift“ als Chiffre für die Uneigentlichkeit der Sprache selbst.
1.7 Was sind Theismus, Deismus und Pantheismus
Theismus, theistisch: Vorstellung eines persönlichen Gottes, der als Schöpfer der Welt den Menschen die Wahrheit qua Willensakt offenbart und auch noch wie vor lenkend in den Weltenlauf eingreift.
Der Begriff wird aber auch allgemein als Gegenbegriff zu Atheismus verwendet, um den Glauben an einen persönlichen Gott zu bezeichnen. Bis in das späte 18. Jahrhundert werden die Begriffe Theismus und Deismus oft synonym gebraucht.
Eine typische theistische Vorstellung liegt dem sog. Okkasionalismus (N. Malebranche) zugrunde, wonach Gott immer wieder bei Gelegenheit (lat. „occasio“ = Gelegenheit) in das Weltgeschehen eingreift.
Deismus, deistisch: auch der Deist glaubt an einen persönlichen Gott leugnet aber, dass dieser in das Weltgeschehen nach der Schöpfung eingreift. Auch offenbart sich Gott den Menschen nach der Schöpfung nicht mehr durch Willensakt.
Der Deismus beruht auf der Vorstellung eines durch die Vernunft, d.h. rational erkennbaren Gottes, der die Welt nach Vernunftgrundsätzen geschaffen hat, danach aber nicht mehr in den Weltlauf eingreift: „Uhrmacher-Gott“ (G.W. Leibniz). Gott ist danach der vollkommene Konstrukteur einer Welt, die die „beste aller möglichen Welten darstellt“ (Leibniz). Ein Eingreifen Gottes ist daher weder möglich noch nötig.
Pantheismus, pantheistisch: der Begriff wurde erst im frühen 18. Jahr-hundert als kritische Kennzeichnung einer Position verwendet, die die Unterscheidung von Gott und Welt, von Gott und Natur aufhebt, und die Gesamtheit aller Dinge und allen Seins mit Gott gleichsetzt. Die Vorstellung eines seiner Schöpfung gegenüberstehenden persönlichen Gottes wird aufgegeben.
Obwohl der Pantheismus bereits bei den Stoikern (Gott ist in seiner Schöpfung real gegenwärtig) vertreten wird, wird er in der Neuzeit mit dem Philosophen Baruch de Spinoza verbunden („deus sive natura“ = „Gott oder auch Natur“). Mit dem Begriff „Spinozismus“, „spinozis-tisch“ wird diese Auffassung daher auch bezeichnet.
An die Stelle der Vorstellung eines personalen wollenden Gottes tritt die eines „all-einen“ Gottes der „nur in sich selbst“ existiert.
EDMUND SANDERMANN 17.10.2021