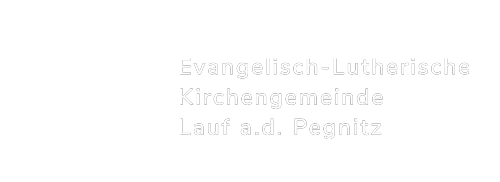Kirchweih Dehnberg (Predigtskizze) von Jan-Peter Hanstein
Lk 18, 9-14 Lektorin Pharisäer und Zöllner

18,9 Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein,
und verachteten die andern, dies Gleichnis:
18,10 Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel,
um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner.
18,11 Der Pharisäer stand für sich und betete so:
Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher
oder auch wie dieser Zöllner. 18,12 Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.
18,13 Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig!
18,14 Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener.
Glaubensbekenntnis
EG 601 „Singt dem Herrn und lobt ihn“
Predigt
Liebe Gemeinde,
Jesus gibt uns hier eine Anleitung zum Beten, wie er es mit dem Vater Unser gegeben hat. HERR LEHRE UNS BETEN!
Es geht nicht um das Gebet an sich, sondern um eine innere Einstellung.
Das ist neu an Jesus – zwei machen äußerlich dasselbe, das verlangte Ritual –
Aber nur der eine ist am Ende vor Gott gerechtfertigt. 18,14
18,9 Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die andern, dies Gleichnis:
Manchmal wäre es besser nur wenige Worte zu beten. Als viele Worte zu verlieren und damit den Überblick auf was es ankommt. Nicht plappern wie die Heiden oder darüber zum Heide zu werden… Analysieren wir das Gebet des „Pharisäers“:
Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute,
-> Danken für etwas, was Gott nicht gegeben hat. Dazu Hochmut: sich darüberstellen und Verallgemeinerung: nicht wie die anderen! Wir und die anderen!!
Im Gebet haben wir uns immer solidarisch mit den Menschen zu verhalten angesichts des großen Unterschiedes zu Gott.
Gutheißen der eigenen Taten –> kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher
oder auch wie dieser Zöllner. 18,12 Ich faste zweimal in der Woche und gebe
den Zehnten von allem, was ich einnehme.
Braver Kirchensteuerzahler …
Der Pharisäer sieht an sich nur das, was sowieso erlaubt und gewünscht ist. Ein Mensch, der sich nach dem Durchschnitt vergleicht und Gott auch noch dafür dankt. Es fehlt jegliche innere Suche, jede Frage die Gott an uns stellt, und von Gott wird nichts verlangt, keine Bitte, kein Lob – nur Dank für das Gegebene und gegebenen Umständen. Dazu glaubt er frei beten zu können und plappert munter vor sich her.
Sehen wir auf den Zöllner:
18,13 Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig!
Wir haben uns angewöhnt zu sagen, dass alles Formelhafte, Gewohnte quasi „pharisäerhaft“ ist.
Alles Individualistische Freie sei dagegen von Jesus erwünscht.
Gerade das kann ich aus der Geschichte nicht herauslesen!!
Der Zöllner betet durchaus nicht frei. Sondern das vorgeschriebene Formular zur Sündenvergebung. Mit Gesten der Reue und des Respekts.
Deshalb: (liebe konfis)
Das Sündenbekenntnis am Anfang: natürlich ist es formelhaft. Aber doch verbindet es uns mit allen Konfessionen der Welt. Erfahrung in England: Jugendgottesdienst, Farben, Laser alles: Sündenbekenntnis nach Common Prayer Book zu Zeiten von King James und – los ging es …
Und siehe dieser ging gerechtfertigt hinunter nach Hause …
ORT DES LERNENS Daher die Psalmen als Schule des Gebets!
Lk 18,10 Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel,
„Hinauf in den Tempel:“
Am Tag der Kirchweih frage ich: Warum überhaupt in einen Tempel oder eine Kirche: können die beiden nicht zu Hause beten?
Ist Gott nicht überall?
Ja – aber wo die Gemeinde zusammenkommen will, da werden überall Häuser gebaut.
Aufgrund der Erfahrung auf Reisen zumindest in PNG – An den heiligen Stätten, den Kirchen kann man gleich sagen, in welchem Zustand die Gemeinde ist.
Deshalb braucht es das Korrektiv der Gemeinschaft, des regelmäßigen Ortes und der Zeit. Alles andere ist Augenwischerei. Wir brauchen unsere Kirche, und wir sollten sie auch so pflegen, das wir diese Sorgfalt und der Respekt vor dem beten in diesem Haus sichtbar wird. Mit den schönen Blumen, mit dem baulichen Zustand und alles drum herum. Ich freue mich an dem renovierten Kirchturm und der neuen besseren Zugänglichkeit.
HERR LEHRE UNS GEMEINSAM BETEN!
Es ist nämlich ein protestantisches Missverständnis, zu meinen, bräuchten die Kirche nicht mehr als Ort der Sündenvergebung, des Hörens auf die Schrift und des Feierns der Sakramente, das alles wäre „äußerlich“! Das ist für mich unernstes Geplapper!
Kirche und Gemeinde braucht eben auch Räume und Orte. Für die Form, das Formular, die Wiederholung, den gewohnten Ort.
Hier in der Kirche und zu Hause. Wir brauchen die Tradition und das Verständnis dafür, damit wir nicht in eine Gotteslästerung hineinfallen, die wir dann nicht einmal mehr merken.
Trotzdem: Wir verlieren beschleunigt viele Mitglieder. Ich weiß nicht, welche Häuser unsere Kirchengemeinde wird aufgeben müssen. Manche Nutzungen werden sich wieder rückwärts bewegen, so wie die Verringerung der Anzahl der Gottesdienste in unserer Gesamtgemeinde. Natürlich steht da die Kirche Dehnberg als kleinster Ortsteil unter besonderem Druck. Wir schließen uns als Kirchenvorstand zusammen, um Dehnberg mit hineinzunehmen in das lebendige Leben der Gesamtgemeinde mit vielen anderen Aktivitäten.
Ich rufe die Kirchenvorsteher und alle anderen dazu auf, die es ernst meinen, mit sich und mit dem, was Gott mit ihnen vorhat, unsere Kirchengebäude nicht zu vernachlässigen und es gegen etwas anderes Subjektiveres zu setzen. Wir verlieren dann alles: das Gebet, den Lobgesang, und die Feier.
Jede Generation hat auch die Aufgabe, ihre Zeit nicht zu verpassen.
Ich wünsche, dass wir die 7 Kirchen unserer Kirchengemeinde in Ehren halten und erhalten. Johanniskirche, Dehnberg, Kunigundenkapelle, Salvator, Günthersbühl, Christuskirche und St. Jakob.
Wenn wir uns in Konkurrenz zu anderen sehen in unserem Glauben, dann ist der Tod schon im Topf. Ich bevorzuge das alte Wort „Kirchspiel“ – miteinander spielen, singen und zusammenarbeiten zum Lobe Gottes.
Vieles in unseren Gottesdiensten wird andere und neue Formen annehmen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wichtig ist, dass wir nicht auf andere zeigen und glauben besser zu sein. Gott lenkt den Blick des Zöllners auf sich selbst und dann kann er ihn in die Gemeinschaft einfügen.
Wir brauchen das heilige, Abgegrenzte, das Andere – das TEMPLUM – in unserem Leben, weil sonst alles nur noch Selbstbestätigung oder Selbstperfektionierung wird wie eine Fernsehwerbung!
Die Nikolauskirche wird ihre Funktion erhalten. Noch mehr. Ich wünsche mir, dass sie geöffnet wird für alle Dehnberger Bürger und die Wanderer, damit sie viele Erfahrungen wie der des Zöllners machen können.
Und siehe dieser ging gerechtfertigt hinunter nach Hause …
AMEN.