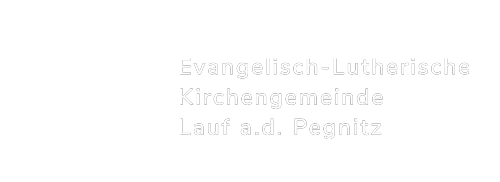1. Fastenpredigt
Sonntag 01.03.26 um 9:15 Uhr | Br. Christian Hauter | Johanniskirche
Das JohannisTeam ging in sich, bei der Auswahl des Themas für 2026. Das, was sofort und organisch ganz oben lag, war die schwierige Situation in Welt und Gesellschaft. „Man mag gar keine Nachrichten mehr anschauen“ sagte einer spontan auf die Frage, was jede und jeden gerade so beschäftige. Das war im September und nach meiner Beobachtung hat sich an diesem Gefühl der Weltbeschreibung nicht so viel geändert.
Diesem Gefühl sollen nun ein Hoffen und Sehnen nach Bewältigung und Umgang gegenübergestellt werden.
So entstand schnell das Thema der diesjährigen Fastenpredigten:
„Seid getrost und unverzagt – Zuversicht in bewegten Zeiten?!“
Unsere zwei Prediger und unsere Predigerin kommen aus unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Die Gestaltung und Bewältigung des Lebens im Bereich einer Ordensgemeinschaft, einer Software-Firma und einer Firma im sozial-kirchlichen Bereich sind der Hintergrund der Prediger und der Predigerin. Und natürlich bringen sie auch ihren ganz individuellen Blick auf das Leben und ihre individuelle Art und Strategie ein, wie sie persönlich mit den Herausforderungen des Lebens umgehen als Christ oder Christin. Nach den Gottesdiensten in der Johanniskirche können Sie den PredigerInnen beim Kirchenkaffee im Johannissaal begegnen.
Fastenprediger Br. Christian Hauter
Bruder Christian Hauter, Jahrgang 1962, hat Abitur in Hersbruck gemacht und anschließend in Erlangen evangelische Theologie studiert. Nach seinem Vikariat in Betzenstein ist er 1991 in die Christusträger Bruderschaft eingetreten. Von 2005 bis 2020 war er Prior dieser Gemeinschaft. Zu seinen Aufgaben gehörten Besuche der Stationen in Kabul/Afghanistan und Vanga/Kongo sowie die Leitung des Gästehauses in Triefenstein.
Bruder Christian war auf Einladung der Basarfrauen zuletzt im November 2025 mit Br. Friedhelm in Lauf. Gemeinsam berichteten sie von der Arbeit im Hospital in Vanga.