Die Livestreamer der Kirchengemeinde – Lebensader in der Corona-Pandemie
Es gibt eine Werbekampagne der Bundesregierung während der Corona-Pandemie, in der gefragt wurde, was man während dieser Krise getan habe. Wenn mich das jemand fragen würde, dann antwortete ich: „Wir haben Livestreams von Gottesdiensten gemacht!“ Und wenn mir das jemand Anfang 2020 gesagt hätte, dann hätte ich ihn nicht ernst genommen…










Was braucht man also für einen Livestream? Bei uns in der Gemeinde war das ein technik- und medienbegeisterter Pfarrer, der schon kurz vor Beginn des ersten Lockdowns den Anstoß gab, Gottesdienste live im Youtubekanal zu übertragen. Dazu kam ein medienbegeisterter Ehrenamtlicher mit seinem Sohn, die, zunächst noch etwas ablehnend, diesen Gedanken aufgriffen und zur Tat schritten. Und schließlich waren wir in Lauf in der glücklichen Situation, über eine Kirche zu verfügen, die mit einem Audio- und einem Videomischpult ausgestattet war und in der die Lieder während des Gottesdienstes schon seit langem mit einem PC eingeblendet wurden. Halt, aber da fehlen doch noch die Kameras, wird der ein oder andere einwerfen. Ja, glücklicherweise fand sich ein Kamerateam, das gerade „arbeitslos“ und bereit war, seine professionellen Kameras nicht nur zur Verfügung zu stellen, sondern sie auch gleich zu bedienen.
Und so konnten die Livestreams dann starten… Das hört sich im Nachhinein sehr einfach an – war es teilweise auch – technische Feinheiten lasse ich mal weg. Unsere Gemeinde war auf diese Weise in der Lage, wöchentlich über vier Monate hinweg Gottesdienste live in HD-Qualität zu übertragen, die mit der Homepage der Gemeinde verlinkt waren und so mehrere hundert „Gottesdienstbesucher“ erreichten. Aktuell hat der erste gestreamte Gottesdienst vom 22.3.2020 über 5000 Aufrufe bei Youtube – so viele Personen hätten wir in einem Gottesdienst in keiner unserer Kirchen begrüßen können. Für den Kindergottesdienst drehte ein Team eigene Filme, die parallel zum oder nach dem „Erwachsenengottesdienst“ angeschaut werden konnten.
Aber natürlich gab es auch so etwas wie „Abnutzungserscheinungen“: Irgendwann musste die Gemeinde eigene Kameras anschaffen, was dank großzügiger Spenden möglich war. Das größere Problem war aber die Belastung der Mitarbeiter, denn Woche für Woche einen Livestream aufzunehmen, dem auch noch eine Probe am Samstag vorausging, geht irgendwann an die Substanz. Und da erst komme ich ins Spiel, denn nach den Sommerferien wurde ein zweites Team aufgebaut, das auch hauptsächlich aus Ehrenamtlichen besteht und seit Ende September 2020 aus einer weiteren Laufer Kirche im zweiwöchigen Wechsel mit dem anderen Team Livestreams sendet. Wir profitierten enorm von den Erfahrungen des „Ursprungsteams“, das dieses auch in vollem Umfang weitergab, sodass wir nicht bei Null starten mussten. Hinzu kommen begeisterte junge Leute, die jede Woche mit riesigem Engagement dabei sind und dabei helfen, Gottesdienste mit Bild und Ton zu übertragen. Wobei sich der „gute“ Ton fast schon als das größere Problem darstellt… Wie nimmt man den Ton einer Geige ab? Wie stellt man eine mehrköpfige Band coronakonform auf? Mit welchen Instrumenten haben wir es beim nächsten Gottesdienst überhaupt zu tun? Und wie viele Personen singen eigentlich? Hier hat sich eine gründliche Planung als beste Grundlage herauskristallisiert. Schon zur Probe am Samstag liegt ein relativ detaillierter Ablaufplan vor, sodass jeder Teilnehmer weiß, wo er wann sein muss, wann welches Lied kommt oder welcher Text als Epistel gelesen wird. Denn sowohl Liedtexte als auch die Lesungen werden natürlich im Bild auch eingeblendet. Aber auch bei der Kameraführung und beim Videoschnitt müssen Regeln für das „gute Bild“ beachtet werden, damit niemand abgeschnitten ist oder auf dem Bild zu klein erscheint. Nach ungefähr 50 Livestreams hat sich mittlerweile eine gewisse Routine eingespielt, was aber nicht bedeutet, dass besondere Gottesdienstformen auch wieder besondere Herausforderungen darstellen.
Auch die musikalische Gestaltung der Streaming-Gottesdienste hat sich im Laufe des Jahres verändert: Durften zu Beginn nur Hauptamtliche wegen der strengen Coronaauflagen musizieren, gestalten nun auch wieder Ehrenamtliche die Gottesdienste mit. Es wird rege zwischen Bandmusik und klassischer (Kirchen-) Musik abgewechselt, sodass die große Bandbreite der Laufer Kirchenmusik im Kleinen dargestellt werden kann. Profi-Musiker erhalten während der Pandemie Auftrittsmöglichkeiten und werden damit finanziell unterstützt und auch die einzelnen Gottesdienstprofile der Großgemeinde sind spürbar. Natürlich fordern die Proben (sowohl als Ensemble/Band plus Technikproben) den Musikern im Stream enorm viel Zeit ab, doch es ist gerade während aller Beschränkungen wunderbar live musizieren zu dürfen. Gott sei Dank verfügt unsere Kirchengemeinde über sehr gute Technik und Ehrenamtliche zum professionellen Mischen und Abnehmen eines guten Tons!
Auch wenn ich mir bewusst bin, dass Livestreams besonders in Bezug auf das Erleben der Gemeinschaft im Gottesdienst ihre Nachteile haben, haben sie aber auch eindeutige Vorteile: Dadurch, dass wir die Kamera nicht einfach mitlaufen lassen, sondern dass der Gottesdienst auf die Aufnahmen zugeschnitten ist, erreichen wir, dass der Zuschauer sich unmittelbar angesprochen fühlt, da er ja förmlich persönlich vom Pfarrer in seinem Wohnzimmer angesprochen wird. Hinzu kommen spezielle Kameraperspektiven, die Bilder ermöglichen, die ein „normaler Gottesdienstbesucher“ von seinem Platz in einer der hinteren Bänke gar nicht wahrnehmen kann. Und schließlich sind Einblendungen von Bildern oder Texten definitiv am Bildschirm besser erkennbar, als wenn sie per Beamer an die Wand geworfen werden. Ein weiterer großer Vorteil des Livestreams ist außerdem, dass so auch „große Gottesdienste“ möglich waren, die in Präsenz zu Coronazeiten nicht möglich gewesen wären. Ich denke hier besonders an die Abschiedsgottesdienste von David Geitner oder von Friederike Hoffmann. So konnten an diesen Gottesdiensten viel mehr Menschen teilnehmen, als es coronabedingt in der Kirche der Fall gewesen wäre. Und ihnen allen steht die Livechat-Funktion zur Verfügung, um so noch persönliche Wünsche und Grüße weiterzugeben.
Was bleibt als Fazit: Ein großer technischer Aufwand, der auch die Mitarbeit von vielen Ehrenamtlichen erfordert; der aber gleichzeitig das Potenzial bietet, junge Menschen an die Mitarbeit in der Kirchengemeinde heranzuführen. Die Chance, selbst etwas Neues zu lernen und die Chance, das Wort Gottes auf einem neuen Weg unter die Menschen zu bringen. Letztendlich auf diesem Wege als Kirchengemeinde für die Gemeindemitglieder da zu sein, auch wenn jeder Einzelne für sich alleine zu Hause sitzt.
Heiko Brandt, Philipp Höcht, Silke Kupper
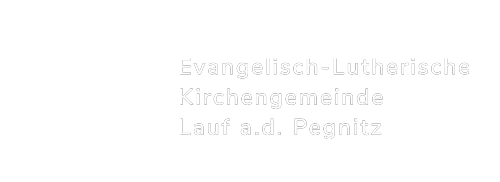



.jpg)











