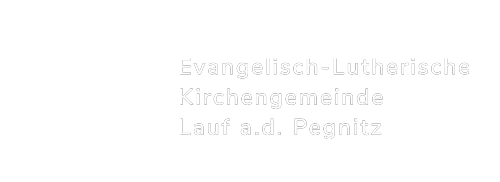Wie wir dem lieben Gott ein Haus bauten
Die Geschichte vom Bau der Kirche in Günthersbühl
VON HANS GRÖSCHEL
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Pegnitz-Zeitung aus FUNDGRUBE, Beilage der Pegnitz-Zeitung für Heimatkunde und Lokalgeschichte, 36. Jahrgang, Heft 4, Oktober 1995
Die Geschichte des bekannten Laufer Heimat- und Mundartautors ist der teils besinnliche, teils heitere, aber immer wahre Bericht darüber, wie das Kirchlein in dem Laufer Ortsteil entstanden ist. Der Autor, als junger Lehrer in Günthers- bühl, hat den Bau mit initiiert und tatkräftig gefördert.
Im Mittelpunkt der Geschehnisse standen, wie es damals in einem kleinen Dorf üblich war, der Pfarrer, der Bürgermeister, und ich – der Lehrer.
Der Pfarrer: groß, knochig, ein Bauernsohn aus dem Ries mit einer Stahlnickelbrille und mit riesigen Händen, die zupacken konnten. Mit guten Händen, unter denen wir uns geborgen fühlten, wenn er sie segnend über uns hielt.
Und dann der Bürgermeister, klein und flink wie ein Wiesel, ganz der Typ eines pfiffigen Bäuerleins, dessen ganzer Stolz damals ein blauer Trachtenhut war, den er mir nach einer langen, viel zu langen Singstunde morgens um drei Uhr zwischen Oedenberg und Günthers- bühl infolge meines desolaten Zustands für eine Mark abgekauft hatte.
Der Bürgermeister und ich waren Freunde von Anfang an, besonders weil er sich bei meiner ersten Besichtigung des alten Schulhauses erbot, dieses zur Verbesserung meiner Arbeits- verhältnisse gleich in der nächsten Nacht höchstpersönlich anzuzünden.
Ich konnte ihn von diesem Vorhaben abhalten, denn ich war froh, als junger Lehrer ein Dach über den Kopf zu bekommen – und eine Wohnung mit 120 Quadratmetern für sieben Mark im Monat. Einschließlich Heizung natürlich!
Und in dieser Wohnung, genau in der großen Wohnküche, fing die Geschichte an.
Es war am Montag nach dem 3. Adventssonntag im Jahre 1952. Der Pfarrer, der Bürger- meister und ich – der Lehrer, wir saßen in unserer Küche und hatten ein Problem: Nachdem es im Ort keine Kirche gab, fanden die Gottesdienste und die Bibelstunden immer im Schulzimmer statt.
Die Erwachsenen, die sich mit Gewalt in die zu kleinen Schülerbänke zwängen mußten, lockerten und sprengten die Holzverbindungen der stabilsten Fünfsitzer. Außerdem hinter- ließen sie nach den Wegen von Nuschelberg und Oedenberg halbe Kartoffeläcker von ihren Schuhen, so daß vor dem Schulbeginn eine zusätzliche Reinigung des Schulzimmers notwen-
dig war. Und für diese zusätzliche Arbeit verlangte die Putzfrau einen zusätzlichen Lohn von 50 Mark pro Jahr. Ihr Jahreslohn von 250 Mark hätte sich somit auf 300 Mark erhöht.
Ich war sofort für die Erhöhung, weil es erstens einmal nicht mein Geld war, das da ausgegeben werden sollte, und zweitens, weil ich es nicht mit der Putzfrau verderben wollte, die auch in unserer Lehrerswohnung für zwei Mark die Stunde putzte.
Der Pfarrer erbot sich, in christlicher Demut den Schulsaal nach jedem Gottesdienst und jeder Bibelstunde eigenhändig zu reinigen. Außerdem erbot er sich, die wackligen Schulbänke in den Ferien wieder zusammenzuschrauben. Dem Bürgermeister gefielen alle diese Vorschläge nicht: „So hoch müssen wir die Sache nicht gleich hängen. A Zwanziger langt dou vielleicht aa scho für die Kuni!“
Und dann stand plötzlich die Frage im Raum, die eine alte Dame in ihrem Austragsstübchen dem Pfarrer so oft gestellt hatte: „Warum hat ein Dorf wie Günthersbühl eigentlich keine Kirche?“ Und dann: „Ja, warum bauen wir eigentlich keine Kirche?“
Ich sagte: „Wenn jeder etwas gibt und alle zusammenarbeiten, warum soll das nicht gehen?“
Der Bürgermeister sagte: „Ich bin dafür, aber den Gemeinderat müssen wir zuvor fragen!“ „Und den lieben Gott“, ergänzte der Pfarrer. Und was er damit meinte, das haben wir erst in den nächsten Wochen und Monaten erfahren.
Ich fing gleich am nächsten Tag an, den Entwurf für einen Bauplan zu zeichnen und mit dem Rees, einem Maurer, und dem Scheibel, einem Zimmermann, zu berechnen. Es sollte ein einfacher Betsaal werden, mit einfachen Türen und Fenstern und einem flachen Dach aus Eternit.
Wir errechneten für den Rohbau aus Hohlblocksteinen und Dachbalken nach den damaligen Preisen 2750 Mark und sieben Festmeter Holz für Dachgebälk und Fußboden.
Dabei gingen wir von folgenden Voraussetzungen aus: das Grundstück für die Kirche darf nichts kosten. Alle Arbeiten werden kostenlos in Gemeinschaftsarbeit verrichtet. Für den Betsaal stiftet jeder einen Stuhl oder bringt ihn zum Gottesdienst bzw. zur Bibelstunde mit.
Sammlung von Haus zu Haus
Am ersten Weihnachtsfeiertag gab dann der Pfarrer nach dem Gottesdienst der Gemeinde bekannt, daß in Günthersbühl in Gemeinschaftsarbeit ein Betsaal gebaut werden sollte. „Dazu gehen der Herr Lehrer, der Herr Bürgermeister und ich am Sonntag von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln. Jeder schreibt auf einen Zettel wie viel er geben will und wann er es geben kann. Auch wie viel Holz er geben will, kann er auf den Zettel schreiben. Keiner soll vom anderen wissen, was er gibt und wie viel er gibt. Wir brauchen 2750 Mark und sieben Festmeter Holz.“ Das war unser Ziel, als wir, der Pfarrer, der Bürgermeister und ich, der Lehrer, von Haus zu Haus gingen und die Zettel mit den Spendenzusagen einsammelten. Keiner aus dem Dorf schloß sich aus, sogar die Katholiken beteiligten sich an der Spendenaktion. 2750 Mark waren damals kein kleiner Betrag.
Am Abend saßen wir dann mit unseren Spendenzetteln in unserer Küche und rechneten zu- sammen: es waren 2755 Mark und sieben Festmeter Holz. Ich gab die Zusammenstellung wortlos meiner Frau. Und da diese mit Recht und aus Erfahrung meinen Rechenkünsten miß- traute, rechnete sie nach – und kam auf 2755 Mark, auf fünf Mark mehr, als wir auf dem Kostenvoranschlag errechnet hatten.
„So“, sagte der Pfarrer und falte die Hände. „Jetzt hat Gott ja gesagt, jetzt dürfen wir bauen.“ Und der Ludwig, der ein echter Bürgermeister war, schüttelte gedankenvoll seinen Kopf. „Des mit dem Holz, die sieben Festmeter stimmt genau – und des mit denen 2755 Mark, des stimmt auch genau. Wir hobn nämlich bei unserem Kostenvoranschlag vergessen, daß mir in die Gemeindekasse fünf Mark Plangenehmigungsgebühr bezahlen müssen!“
Als dann, viel später, der Herr Pfarrer mit seinem Fahrrad in der dunklen Nacht nach Lauf unterwegs war, da fühlte sich der Bürgermeister auf wie Rumpelstilzchen. „Von wegen Betsaal, von wegen Stühle zum Stellen, das kommt gar nicht in Frage. Jetzt bauen wir eine richtige Kirche – mit Orgel und Bänken und einem Turm mit einer Glocke! Dafür werde ich schon sorgen!“
Aber, der liebe Ludwig, der brauchte sich nicht zu sorgen, das nahm ihm und uns ein anderer ab.
Ein Berufsschullehrer, der Hufsky-Papa, wie wir ihn liebevoll nannten, zeichnete den Bauplan nach unseren Entwürfen, eine Kirche, wie sie uns gefiel, vorne mit Rundbogen, hinten mit Orgelstube und auch einem Dachreiter für eine Glocke, den der Bürgermeister in seinem bäuerlichen Stolz „Kirchturm“ nannte.
Ich begann dann mit meinen Schülern eine Unterrichtseinheit, in deren Mittelpunkt der Kirchenbau stand. Heute würde man „Projekt“ oder „Vorhaben“ dazu sagen. Mit den Kindern fing ich zunächst an, den Humus abzutragen und die Gräben für die Fundamente zu ziehen. Wir berechneten die Materialkosten und rechneten jede Lieferung nach. Dabei führten wir Buch über Hohlblocksteine und Zement. Aus der Sandgrube holten wir mit Handwagen und Zinkwannen den Bausand – wenn gerade kein Bauer uns eine Fuhre lieferte.
Ein alter Maurer, der Herr Hupfer, wie er sehr respektvoll genannt wurde, lenrte den Acht- klässlern das Mörtelmachen, daß In-die-Waage-Legen einer Mauer, das Anlegen eines Winkels.
Das alles geschah aber nicht immer in der Unterrichtszeit. Jeden Nachmittag war eine Schülergruppe verantwortlich, daß immer Wasser an der Baustelle war. Manchmal fragte ich mich oft ohne Reue, was wohl beruflich aus mir geworden wäre, wenn in dieser Zeit der Schulrat unangemeldet zu mir gekommen wäre! Wie weit waren wir weg von den Themen der Lehrpläne und wie nah waren wir dem Leben, dem Lernen für das Leben, das nicht nur den Schülern Spaß machte, sondern auch den Lehrer.
Am Abend kamen dann die Bauern, die Waldarbeiter und die Handwerker und arbeiteten an der Kirche bis in die Dunkelheit hinein – Tag für Tag, nur nicht an Sonntagen. Dass der Sonn- tag geheiligt blieb, darüber wachte der Pfarrer mit Argusaugen.
Die Gemeinde war bereit, für den Kirchenbau kostenlos ein Grundstück zur Verfügung zu stellen. Leider lagen diese Grundstücke alle etwas weit ab vom Ortskern. Die Versuche, ein näheres Grundstück auf dem Tauschweg zu erwerben, scheiterten. Da pfiff an einem Vor- mittag der Fritz, unser Kolonialwarenhändler, von der Straße aus mitten in meine Rechen- stunde hinein: „Lehrer, du sollst sofort ins Krankenhaus kommen, der Stoffelbauer braucht Blut. Aber schnell soll’s gehen.“ Ich gab meinen 54 Kindern Rechenaufgaben für zwei bis drei Stunden, bat den lieben Gott um Schutz vor Schulratsbesuchen und anderen Betriebsunfällen, dann übertrug ich die Schulaufsicht meiner Frau, schwang mich auf mein Motorrad und fuhr die Steinmauer hinunter zum alten Krankenhaus in der Galgenbühlstraße.
Dort erwartete mich im langen Gang schon der Doktor Völker, Chefarzt und Chirurg, der schon vielen Menschen durch seine Operationskunst das Leben gerettet hatte.
Der Doktor Völker, einziger und somit Chefarzt des Laufer Krankenhauses, der mich von Kindesbeinen an als Hausarzt betreute, war ein leidenschaftlicher Chirurg – und ein guter noch dazu. Die Leute, die damals dem neuen Friedhof den Namen „Völkerschlachtdenkmal“ geben wollten, taten ihm bitter Unrecht.
Ich war in dieser Zeit einer seiner wichtigsten Blutspender der Blutgruppe 0. Der Doktor führte, wie bei jeder Bluttransfusion, bei mir eine Generaluntersuchung durch. Er stieß seinen Zeigefinger in meinen Unterbauch und erkundigte sich detailliert nach Kavalierskrankheiten in diesem Bereich. Meine empörte Verneinung genügte ihm als qualifiziertes Untersuchungsergebnis, und er schob mich selbst auf eine Liege in den Operationsraum. Dort
lag der Stoffelbauer blass und mager auf dem Tisch. Er machte nur kurz seine Augen auf und begrüßte mich mit einem schwachen Lächeln des Erkennens. Dann wurden wir mit zwei Schläuchen miteinander verbunden. Der Doktor Völker pumpte mein Blut aus mir heraus und in den Stoffelbauern hinein. Und während dieser Prozedur war der Stoffelbauer plötzlich ganz da: „Lehrer“, sagte er fast flüsternd, „habt ihr jetzt schon ein Grundstück für die Kirche?“ Und als ich verneinte, fuhr er fort: „Wenn ich wieder gesund werde und wieder daheim bin, kriegt ihr meinen Obstgarten beim Feuerwehrhaus für die Kirche!“ „Das ist ein Wort“, sagte der Doktor und holte für den Stoffelbauern eine zusätzliche Blutration aus mir heraus.
Zwei Wochen später war der Stoffelbauer daheim. Mit Handschlag übereignete er uns seinen Obstgarten als Bauplatz für die Kirche. Und nun konnte es richtig losgehen.
Ich war der Kassenverwalter für den Kirchenbau. In einer Zigarrenkiste hatte ich das Geld. Die Spenden gingen regelmäßig ein, und ich war selten in Geldnot. Aber einmal mußte uns der liebe Gott doch aushelfen.
Es kam von der Firma Mörtel eine Rechnung über 232 Mark für Hohlblocksteine. In meiner Zigarrenkiste waren gerade noch 32 Mark. Ich setzte mich auf mein Motorrad und fuhr nach Lauf, um die Firma Mörtel um Stundung des Betrages zu bitten. Meine Rede hatte ich mir genau überlegt: „Herr Mörtel, wir können die Rechnung noch nicht bezahlen. Von den 232 Mark habe ich hier nur 32 Mark dabei …“ Der Herr Mörtel unterbrach mich und gab mir einen Umschlag. Auf dem Umschlag stand „Für den Kirchenbau in Günthersbühl“. Ich machte den Umschlag auf. Im Umschlag steckte ein Hundertmarkschein. Damit konnte ich gleich einen weiteren Teil der offenen Rechnung bezahlen. 32 Mark und 100 Mark, das waren 132 Mark. Jetzt fehlten nur noch 100 Mark. „Und“, sagte der Mörtels Maurerer – wie er überall genannt wurde, „vielleicht hat’s Ihnen der Herr Pfarrer noch nicht gesagt, aber meine Tochter heiratet am Samstag, und da gebe ich 100 Mark für die Kirche. Wenn Sie die auch noch abziehen, dann sind die 232 Mark bezahlt. Bloß, eine Quittung wünsche ich schon darüber.“ Und die bekam er natürlich auch.
Das mit dem Geld, das war überhaupt so eine Sache. Unsere Finanzierung stimmte schon lange nicht mehr – denn wir bauten ja jetzt eine richtige Kirche. Als die Kosten für Türen, Fenster, Bänke immer näher auf uns zu kamen, dachte ich immer öfter an einen Kredit von der Sparkasse. Dem Pfarrer passte das nicht in sein Denken: „Wenn der liebe Gott will“, sagte der Pfarrer, „dann bekommen wir das Geld auf andere Weise.“
Unverhoffter Kredit
Als dann die Zahlungsverpflichtungen in Form von Rechnungen immer größer wurden, willigte der Pfarrer schweren Herzens ein, bei der Sparkasse einen Kredit in Höhe von 10.000 Mark aufzunehmen. Wir, der Pfarrer, der Bürgermeister und ich, gingen zum Kreditsachbearbeiter, meinem Freund Albert Knabenbauer, um einen förmlichen Antrag zu stellen. Als die Frage nach Sicherheiten gestellt wurde, sah mich mein Freund Knabenbauer nicht an. Er wusste, daß ich nichts hatte. Der Pfarrer hatte auch keine Sicherheiten. Da blieb nur der Bürgermeister mit seinem Hof. Durch dessen Grundbesitz waren wir kreditwürdig. 10.000 Mark wurden uns in Aussicht gestellt. Vor der Sparkasse trafen wir eine Kollegin. Wir plauderten, und ich erzählte von unserer Kreditaufnahme und von den Bedenken des Pfarrers. Die Kollegin nickte verständnisvoll und kramte in ihrer Handtasche. Sie brachte einen Umschlag heraus, den sie dem Pfarrer gab: „Hier haben sie 10.000 Mark. Ich leihe sie Ihnen. Vor ein paar Tagen habe ich es abgehoben, weil unser Haus neu verputzt werden sollte. Nun haben die Handwerker abgesagt und ich wollte das Geld wieder auf die Sparkasse geben. Bis zum Herbst leihe ich Ihnen das Geld gerne!“ Zehn Minuten später war das Geld auf unserem Konto. Wir hatten
10.000 Mark und konnten alle Rechnungen bezahlen. „Seht“, sagte der Pfarrer und legte uns seine langen Arme um die Schulter, „so sorgt der liebe Gott für uns!“ Dann konnten wir das Richtfest feiern. Am Vormittag gingen die Kinder mit Schüsseln und Taschen von Haus zu Haus und sammelt Brot, Würste und Schinkenstücke für das „Hiebmahl“. Am Abend, einem Samstag, saß dann die ganze Gemeinde auf Stühlen und Steinen oder nur im Gras vor dem Rohbau unseres Kirchleins. Der Zimmermann sagte seinen Spruch, wir sangen einen Choral,
und der Pfarrer hielt eine Predigt. Dann ging er durch die Gemeinde und gab jedem ein Stück Brot, eine Wurst oder ein Stück Schinken und jeder – auch wenn er durch Zufall seine eigene Wurst wiederbekam – nahm diese Gabe aus den Händen des Pfarrers in Dankbarkeit an.
Ich saß bei dem Richtfest auf einem Stoß aus Dachziegeln und dachte daran, wie wir zu diesen Ziegeln gekommen waren. Montag war bei uns an der Schule immer Pfarrertag. Der Pfarrer kam von Lauf, hielt Unterricht von zwei bis vier Uhr und machte dann Hausbesuche bei Gesunden und Kranken. Nach dem Abendessen bei uns oder sonstwo hielt er dann ab acht Uhr noch Bibelstunde. An einem Montag stoppte ein Personenwagen vor dem Schulhaus. Ein sehr gut gekleideter Herr stieg aus und erkundigte sich bei mir nach dem Pfarrer. „Der ist oben im Schulzimmer und hält Religionsunterricht! Wenn sie ihn länger sprechen wollen, dann warten Sie doch bei uns. In 20 Minuten ist der Unterricht aus!“
Wir machten uns bekannt, und der Herr sagte: „Ich bin ein Kriegskamerad vom Pfarrer. Wir waren einige Jahre zusammen. Nun bin ich im Rheinland und biete in ganz Süddeutschland unsere Baustoffe an, besonders Dachziegel!“ „Dachziegel“, das war für mich ein Stichwort: wir brauchten doch Dachziegel für unsere Kirche! „Dachziegel“, fragte ich den Kriegskameraden des Pfarrers, „hätten Sie da nicht eine Partie krumme oder leicht beschädigte Ziegel, die nicht viel kosten? Wir brauchen sie für unsere Kirche!“ Der Ziegeleimensch war sehr aufge- schlossen. „Mein Chef, der Ziegelei-Besitzer, hat für die Kirche etwas übrig. Der würde Ihnen die Ziegel vielleicht sogar schenken. Aber wie bringen wir die Ziegel vom Rheinland in Ihr Günthersbühl? Wenn ich von der Firma Güttinger einen Auftrag bekäme, könnte man die Ziegel beiladen!“ „Und, Sie bekommen keinen Auftrag von der Firma Güttinger?“ „Das ent- scheidet sich erst morgen!“
Dann kam der Pfarrer, und die beiden Kriegskameraden begrüßten sich herzlich. Ich aber ging zum Telefon im Kolonialwarenladen und rief die Firma Güttinger an. Mit der Familie Güttinger waren wir verwandtschaftlich verbunden. Der Karl war in der Leitung. Ich erzählte ihm von dem Besuch. „Könnt ihr nicht etwas bei dieser Firma bestellen, damit wir unsere Ziegel bekommen?“ Der Güttinger Karl zeigte sein großes Herz: „also gut. Er bekommt einen größeren Auftrag, damit Eure Kirchenziegel beigeladen werden können.“ „Dafür kommst du einmal in den Himmel“, versprach ich dem Karl und war glücklich über die Lösung unseres großen Problems.
Die Ziegel kamen auch pünktlich, die Bauern fuhren mit ihren Pferden und Traktoren zum rechten Bahnhof, und alles half mit, die Ziegel umzuladen. So bekamen wir unsere Ziegel – und sie kosteten uns keinen Pfennig.
Das Kreuz aus Darmstadt
Die Ausstattung der Kirche war ein großes Problem. Der Semlinger, Lehrlingsmeister in den FAUN-Werken, ließ die Lampen und Leuchten in der Lehrlingswerkstatt schmieden, der Vogels Karl malte uns die Anzeigentafel für die Lieder, der Keilhacks Bimbus baute einen Ofen aus alten Teilen für uns, und die Firma Gramp „vergaß“, uns eine Rechnung für die roten Läufer zu schicken. Aber die größte Sorge war das Kreuz mit einer Christusfigur, das wir uns hinter dem Altar vorstellten. Doch dann erzählten uns die Wißmüllers-Schwestern von den Marienschwestern in Darmstadt. Die „Marienschwestern“, ein evangelischer Orden, bestand aus einer Gruppe von jungen Mädchen, Schülerinnen und Studentinnen. Bei einem Flieger- angriff im Krieg wurden sie verschüttet. Als nach einigen Tagen immer noch keine Hilfe kam, gelobten sie, ihr Leben nach einer Errettung in den Dienst Jesu Christi zu stellen. Sie wurden gerettet, und die meisten hielten sich an ihr Versprechen und gründeten mit ihrer Lehrerin den Orden der Marienschwestern. Alle diese Nonnen übten einen Beruf in ihrer Gemeinschaft aus. Unter diesen Nonnen war auch eine Bildhauerin, die für uns ein zweieinhalb Meter hohes Holzkreuz mit einem aus Ton gebrannten Christuskörper gestaltete. Kostenlos – aber wir mußten das Kreuz in Darmstadt abholen und eine Spende geben.
Als das Kreuz fertig war, fuhren der Pfarrer und ich nach Darmstadt. Dort wurden wir im Kloster herzlich empfangen und bewirtet. In einer Kammer legten wir uns dann auf harten Betten zur
Ruhe. Am anderen Morgen machten wir uns mit unserem Kreuz auf den Weg zum Bahnhof – mitten im Berufsverkehr.
Voraus ging der Pfarrer unbeirrt seinen Weg unter dem Kreuz. Ich, in einem hellen Mantel mit einem schwungvoll geknüpften roten Schal, hielt das andere Ende des Kreuzes und schämte mich vor den neugierigen Augen der Passanten. Die eigentlichen Probleme begannen aber erst am Bahnhof. Ging das Kreuz in den Zug – und wohin dann zwischen den Sitzbänken?
Wir stellten unser Kreuz mitten am Bahnsteig auf und erregten damit die Aufmerksamkeit der Passanten. Wir waren ratlos. Aber nicht sehr lange. Der Zugführer kam, und er schilderte ihm die Sachlage. „Sie haben Glück meine Herren! Am Wochenende haben ein paar Betrunkene im Tanzwagen eine Glaswand zertrümmert. Nun hängt der Gesellschaftswagen an unserem Zug. In dem Wagen können Sie das Kreuz auf die Tanzfläche legen!“ So brachten wir unseren Christus nach Nürnberg und im Packwagen auch nach Lauf. Dort aber wartete schon das nächste Problem auf uns. In Lauf stand mein Motorrad mit Beiwagen. Für die fünf Kilometer nach Günthersbühl ergab sich nun die Schwierigkeit, daß der Pfarrer nicht mit dem Motorrad fahren konnte, weil ihm dabei speiübel wurde. Wir versuchten dann folgende Lösung: ich fuhr das Motorrad. Der Pfarrer saß auf dem Soziussitz hinter mir. Das Kreuz stellten wir senkrecht in den Beiwagen, so daß auf der einen Seite der Christus und auf der anderen Seite der Pfarrer hing. So fuhren wir über die Hirtenbrücke auf der damals sehr schlechten Straße nach Günthersbühl.
Ich fuhr ganz langsam, schon wegen des Pfarrers, der mit geschlossenen Augen betend hinter mir saß. Aber dann wurde uns ein Schlagloch doch zum Verhängnis. Ich fuhr in eine Wasserpfütze, die sich als ein tiefes Loch entpuppte. Es gab einen Krach – und der rechte Arm der Christusfigur brach in Achselnähe ab. Es war schlimm – aber auch wieder nicht arg schlimm. Im Schulhaus reparierte ich mit Uhu, Gips und bunter Kreide den Schaden so, daß man fast nichts mehr erkennen konnte. Ich sehe die Bruchstelle auch heute noch. Und immer wenn ich in Günthersbühl den Gottesdienst besuche, dann gehe ich zum Altar und sage:
„Lieber Gott, verzeihe mir, daß ich dir den Arm gebrochen habe!“
Es gab wenige im Günthersbühl, die sich vom Kirchenbau ausschlossen und nicht irgendeinen Beitrag leisteten. Einer, der sich ziemlich offen gegen den Kirchenbau aussprach, war unser
„Doktor Stuck“, der Ruffs Karre, ein Stukkateur aus Nürnberg, der sich in unserer Gemeinde ein kleines Häuschen gebaut hatte. „A Kirch“, verkündete er mit seiner rauhen Stimme, die wie eine verschnapste Biertrinkertrompete klang, „a Kirch, suwos braucht me in unsere Zeit überhaupt nimmer! Mich werd ihr in dem Haus niemals net sehng!“
Sonst war aber der Karre das, was man einen guten, stets hilfsbereiten Menschen nennen mußte. Dass der Karre mit seiner rauen Stimme nicht im Chor unseres Gesangvereins
„Liedertafel“ mitsang, war schon allein eine gute Tat. Nun hätten wir aber bei der Ausgestal- tung der Kirche dringend einen Stukkateur gebraucht, für den Rundbogen vor dem Altar, für den Altar selbst und für die Kanzel. Aber wenn der Karre nicht wollte?
Dann wollte der Karre doch
Als nach einer Chorprobe das halbe Dorf beim Karteln zusammensaß, sagte ich ganz laut über den Kopf von Ruffs Karre hinweg zum Bürgermeister: „Also Ludwig, in der kommenden Woche muß der Rundbogen mit dem Altar gestuckt werden. Ich rede morgen mit dem Hofmanns Schorsch, der kann das als Maurer und macht uns das auch!“ Plötzlich war Stille im Raum – und der Ruffs Karre schob seinen langen, dürren Hals immer weiter aus seinem ausge- waschenen Hemdkragen heraus. „Wer“, sagte er dann fast verächtlich, „wer soll den Bogen und den Altar stucken? Der Hofmanns Schorsch? Der Mörtelpanscher, bei dem fallen die Mauern doch scho um, wenn einer hustet! Soweit kommt des noch, daß ein Maurer die Arbeit von einem Stukkateur macht!“
Am anderen Tag tauchte der Karre mit seinem Werkzeug in der Kirche auf und hielt eine Rede:
„Ich will nicht, daß sich unser Dorf mit seiner Kirche blamiert! Und ich helfe euch jetzt nicht als Mensch, sondern als Stukkateur!“ Und der Ruffs Karre stuckte den Rundbogen, er stuckte den
Altar und er stuckte die Kanzel und half von da an beim Ausbau der Kirche mit wie jeder andere Einwohner auch.
Bei der Einweihungsfeier saß der Karre zwei Bankreihen hinter dem Bürgermeister und mir. Leider sang er den Choral „Tut mir auf die schöne Pforte“ mit. Es war schrecklich! Der Bürger- meister rutschte schon beim zweiten Vers unruhig hin und her. „Wie der Karre singt, das ist fast schon Sabotage!“ Der Karre sang weiterhin falsch. Ich bin aber sicher, daß auch ihn der liebe Gott gehört hat.
An einem Abend, als wir im Innern der Kirche beschäftigt waren, stand die Hofmanns Frieda in der Kirchentüre und schaute sich um. Sie war schwanger – wie immer. Plötzlich sagte sie ganz laut: „Und wie ist das überhaupt mit einem Taufstein?“ Plötzlich war es ganz still in der Kirche. An einen Taufstein hatten wir wirklich nicht gedacht. Nur der Ludwig fand als Bürger- meister eine Antwort: „Du mit deinen vielen Kindern – und in deinem Zustand, da wäre es richtig, wenn du selber für einen Taufstein sorgen tätest! Keiner braucht einen Taufstein so oft wie du!“ Wir lachten alle – aber dann überlegten wir uns, wie wir zu einem Taufstein kommen könnten. Wir gingen zum Hufsky-Papa, unserem Hausarchitekten, und er zeichnete uns einen Plan für einen einfachen Taufstein: unten eine Steinsäule – oben ein Becken aus Messing getrieben.
Mit diesem Plan marschierten wir zum Grabstein-Meyer und trugen ihm unsere Wünsche vor. Der Steinmetz schaute sich den Plan an, dann uns, dann wieder den Plan und dann sagte er:
„Kommen Sie einmal mit, ich muß Ihnen etwas zeigen!“ Er führte uns zu einem Schuppen. Dort stand unter mancherlei Gerümpel unser Taufstein – fix und fertig. „Das ist das Gesellen- stück von meinem Sohn“, sagte der Grabstein-Meyer, „den können sie gleich mitnehmen, den brauchen wir nicht mehr – und kosten tut er auch nichts.“
Hoch beglückt zogen wir mit dem Taufstein ab. Allerdings gibt es hier eine einfache Erklärung für die wundersame Übereinstimmung zwischen Plan und Ausführung: der Meyers-Sohn war beim Hufsky-Papa in der Berufsschule und hatte von ihm gelernt, wie man Säulen gestaltet.
Im Sommer ging es langsamer. Die Bauern hatten viel auf den Feldern zu tun, aber wir waren sicher, daß unser Kirchlein bis zum zweiten Sonntag im Oktober, dem allgemeinen Kirchweih- fest, fertig sein würde.
Dann merkten wir plötzlich, daß es zwischen uns und dem lieben Gott noch eine Zwischen- instanz gab: die Landeskirche in München. Die Landeskirche nahm mit Freude zur Kenntnis, daß man in Günthersbühl eine Filialkirche zu errichten gedenke. Sie baten zur Bearbeitung des Vorgangs um Übersendung einer Karte, eines Meßtischblattes mit dem Grundstück und einer genauen Beschreibung der Gottesdienstgewohnheiten der Gemeinde mit Angaben über die Altersstruktur der Einwohner und die zu erwartende Anzahl der Kirchenbesucher. Dafür versprachen Sie uns einen fertigen Bauplan in fünffacher Ausfertigung und einen Zuschuss in Höhe von 5000 Mark. Der Satz mit dem Zuschuss gefiel uns am besten. Wir schauten uns nach dem Lesen des Schreibens an – und dann dachten wir an die schon fast fertige Kirche. Schließlich, da wir unsere Kirchenoberen nicht erzürnen wollten, taten wir gehorsam das, was sie von uns wollten.
Wir schickten zur Landeskirche nach München eine Karte, damit man sehen konnte, wo Günthersbühl überhaupt liegt, ein Meßtischblatt mit dem Bauplatz und einen sehr ausführ- lichen Bericht über die Gottesdienstgewohnheiten unserer Gemeinde. Dass die Kirche schon fast fertig war – danach war ja nicht gefragt.
Nach einigen Wochen bekamen wir dann von der Landeskirche einen Bauplan für eine schöne kleine Kirche – die so ganz anders aussah als unser Kirchlein – und 5000 Mark Zuschuss.
Die Sache mit der Glocke
Der Bürgermeister, der auch mit seinem Gewissen kämpfen mußte – wenn auch nicht sehr arg – war ein Realist. „Das Geld, das brauchen wir notwendig. Die Pläne brauchen wir nicht
mehr. Aber sie sind wichtig. Deswegen sperren wir sie vorläufig in den Gemeindeschrank ein!“ Und so kam es, daß keiner mehr von den Planungen der Landeskirche etwas sah oder hörte. Das mit den Bauplänen in der Landeskirche und deren Untergang hat den Ludwig und mich schon belastet. Schlimmer aber noch als die Geschichte mit den Bauplänen war die Sache mit der Glocke.
In dem Kassenbuch über die Einnahmen und Ausgaben beim Kirchenbau steht: Spende von Unbekannt in Höhe von 16,80 Mark. Fast keiner wusste, wer die unbekannten Spender waren, nur der Ludwig, meine Frau und ich.
Und so kam es zu dieser Spende von Unbekannt: Auf dem Dach unseres Kirchleins war ein Dachreiter, ein Turm, wie der Ludwig immer sagte. Dort sollte einmal eine kleine Glocke hängen. Aber noch hatten wir keine Glocke und auch das Geld nicht, um eine zu kaufen.
Unser Pfarrer, der auch in der Nachbargemeinde Neunkirchen Religionsunterricht und Bibel- stunden halten mußte, verstand sich mit dem dortigen katholischen Pfarrer, dem Geistlichen Rat Erlwein, sehr gut. Dem war auch unsere Suche nach einer Glocke bekannt. „Wir haben“, sagte der Geistliche Rat, „eine Glocke übrig, unser Geläut wurde im Krieg vergraben. Nach dem Krieg bekamen wir zum Teil neue Glocken – und die kleine Glocke passte nicht mehr zum Geläut. Wir können sie nicht mehr brauchen. Wenn Sie wollen, können Sie diese Glocke haben. Wir schenken sie unserer Nachbargemeinde zur Einweihung. Sie können die Glocke zu jeder Zeit holen lassen. Ich möchte nur nicht, daß viel darüber geredet wird. Manche Neunkirchener hängen noch an der Glocke, deswegen wäre es gut, wenn die Glocke erst nach Einbruch der Dunkelheit abgeholt werden würde.“
Der Pfarrer sagte das gerne zu und schickte den Ludwig und mich auf den Weg, um die Glocke zu holen. An einem der nächsten Abende fuhren wir los mit der Beiwagenmaschine des Bürgermeisters, um die Glocke abzuholen.
Es war finster, als wir in Neunkirchen vor der Kirche anhielten. Gleich hinter der Türe stand unsere Glocke. Die war gar nicht so klein und hatte außerdem einen hölzernen Läutbalken. Auf der Glocke war ein Bild von der Mutter Maria mit einem lateinischen Spruch drumherum.
„Wos haßt denn dös?“ hat der Ludwig mich leise gefragt. Und ich habe sofort geantwortet:
„Ehre sei Gott in der Höhe!“ Das hat sicher nicht gestimmt. Aber der Ludwig hat kein Lateinisch gekonnt und ich auch nicht mehr. Aber ich wollte mich nicht blamieren, und meine Übersetzung war nicht schlecht, denn der Ludwig sagte „das ist ein schöner Spruch für eine Glocke.“ Der Ludwig löste dann das Transportproblem. „Ich fahr, du setzt dich in den Beiwagen und nimmst die „Ehre sei Gott in der Höhe Glockn‘ auf deinen Schoß.“
Mich hätte die Glocke fast erdrückt. Bei jedem Loch der schlechten Straße nach Lauf bekam ich einen Schlag in den Bauch. „Ludwig“, bat ich den Fahrer, „fahr doch langsamer, bei jedem Schlag haut mir die Glocke den Bauch und alles zusammen.“ „Wennst maanst“, machte der Bürgermeister einen Vorschlag, „dann halten wir beim Peter und putzen a Halbe oder drei!“
Der Peter, das war die Wirtschaft vom Sörgels Peter, die damals noch in der Bahnhofstraße war. Als wir dann so mitten in der Nacht vor dem Rupprechtsgärtchen standen, kamen mir so meine Bedenken.: „Ludwig was machen wir denn mit unserer Glocke?“ „Die Glocke“, hat der Ludwig entschieden, „die nehmen wir mit ins Wirtshaus!“ Und so haben wir es trotz meiner Proteste dann auch gemacht. Der Ludwig vorn und ich hinten am Läutbalken, so sind wir in die Wirtsstube hineinmarschiert.
Die vier Kartenspieler, die in einer Ecke der Wirtsstube saßen, hörten sofort mit dem Karten- spielen auf und beobachteten uns mit unserer Glocke. Der Becks Otto hat ein Solo herge- schenkt, weil er so über unsere Glocke staunte. Wir stellten die Glocke mit dem Läutbalken neben unseren Tisch und bestellten uns eine Maß Starkbier. Der Ludwig hat dann den ersten Schluck auf das Wohl unserer Glocke getrunken. Das hat den Kartlern gut gefallen, denn die haben gleich auch mit uns auf das Wohl unserer Glocke getrunken. Und als wir so ein paarmal auf das Wohl der Glocke getrunken hatten, da sagte der Becks Otto: „Jetzt, wenn ihr schon so eine Riesenglocke habt, dann läutet halt ein bißchen!“
Das war in meinen Ohren kein guter Vorschlag, und ich tat so, als hätte ich den Spruch gar nicht gehört. Aber halt, mein Freund Ludwig, der hat sofort ein kleines Geschäft gerochen.
„Wenn du a Moaß zahlst, dann derfst du leitn!“ Der Becks Otto, der hat sich das nur einmal sagen lassen. Er legte ein Zweimarkstück auf den Tisch und machte sich über unsere Glocke her. Der Ludwig und ich, wir haben die Glocke am Läutbalken hochgehoben – und der Otto hat sofort mit dem Schwengel das Läuten „Bim-bam, bim-bam“ angefangen. Und wenn der Ludwig nicht eingeschritten wäre und gesagt hätte: „Schluss – zweimal anschlagen ist genug für eine Maß Bier“, dann hätte der Otto die halbe Nacht geläutet. Aber dem Otto war das Läuten zu kurz. Er hat gleich nochmals zwei Mark auf den Tisch gelegt und wieder mit der Läuterei angefangen. Und dann hat ein anderer Kartenspieler zwei Mark bezahlt und geläutet und dann der dritte Kartenspieler. Und weil der Peter uns das Bier für das Läutgeld immer gleich auf den Tisch stellte und wir das Bier immer gleich tranken, ist das immer lustiger und lauter worden.
Wir waren alle dann so durcheinander, daß wir gar nicht gemerkt hatten, daß der Ludwig selber eine Maß bezahlte, bloß daß er einmal mit unserer Glocke läuten durfte. Und als dann das Läuten zu einem richtigen Sturmläuten geworden war, verbot der Peter das Läuten, weil sonst die Feuerwehr ausgerückt wäre.
Soweit ich mich noch entsinnen kann, sind wir dann mit unserem Motorrad und der Glocke in einer stockdunklen Nacht weiter nach Günthersbühl gefahren. In Rudolfshof, kurz nach der Abzweigung, die nach Günthersbühl in den Wald hineinführt, da hat mich von außen die Glocke gedrückt und von innen das Bier. Und weil dem Ludwig auch das Bier zu schaffen machte, fuhr er an den Rand einer Schonung und hielt an. Wir stellten die Glocke ins Gras und uns daneben. Ziemlich erleichtert fuhren wir weiter und sangen sogar ein Lied vom Gesangverein.
Auf einmal habe ich gemerkt, daß irgendetwas nicht mehr in Ordnung war. Ich habe nach unten gelangt und in die Glocke hinein und habe nach dem Schwengel von der Glocke ge- sucht. Aber der Schwengel von der Glocke war nicht mehr da, der war verschwunden! Ich zog den Ludwig an seiner Lederjacke fast aus dem Sattel. Endlich begriff er, daß er halten sollte.
Der Ludwig hat gleich seinen Kopf in die Glocke hineingesteckt. „Unser Glockn‘ is ka Glockn‘ mehr, waas kann Schwengel mehr hout!“ Wie sind auf diesen Schrecken hin fast wieder nüchtern geworden. Aber dann hat der Ludwig gezeigt, daß er ein echter Bürgermeister ist, der alles weiß. „Lehrer“, hat er festgestellt, „ba aner Glockn mouß der Schwengel immer a weng länger sei, wöi die Glockn selber, wöi der Mantel. Wöi wir die Glockn vurhin abgestellt hoben, houts den Schwengel oben ass der Halterung rausghubn!“
Und nach dieser Erkenntnis hat der Ludwig sein Motorrad gedreht und ist wieder an die Stelle zurückgefahren, an der wir unsere Glocke abgestellt hatten. Das war aber in der Dunkelheit gar nicht so leicht, die Stelle wieder zu finden, denn es war stockfinstere Nacht. An der Stelle, an der wir vorhin gehalten hatten, gingen wir alle zwei auf die Knie und tasteten uns durch das nasse Gras. „Wennst ins Feichte kummst“, meinte der Ludwig, „dann muoßt du dich links halten, waal die Glockn links von uns gstanden is!“
Wir haben sorgfältig gesucht, im Trockenen und im nassen Gras. Erst als der Ludwig mit dem Licht von seinem Motorrad den Grasrand der Schonung abgeleuchtet hat, haben wir den Glockenschwengel gefunden.
Ohne ein Gespräch und ohne ein Lied auf den Lippen sind wir dann weitergefahren. Eigentlich wäre die Geschichte hier schon aus – wenn nicht meine gute Frau gewesen wäre. Meine Frau stand in ihrem roten Morgenmantel in der großen Schulhaustüre. Nach ihrem Gesicht stand uns zwei Glockenholern nichts Gutes bevor. Der Ludwig hat die Glocke mit ausgeladen und dann laut verkündet, daß er jetzt keine Zeit mehr hat und daß er jetzt sofort heim muß. Mit einem höflichen „Gute Nacht, Frau Lehrer“ schwang er sich wieder in den Sattel seines Motorrades.
„Moment, Herr Bürgermeister“, unterbrach meine Frau die Aktivitäten meines Freundes Ludwig, „was heißt hier gute Nacht? Die Nacht ist vorbei!“, fuhr meine Frau mit ihrer Straf- predigt fort. „Woher kommt ihr zwei – und noch dazu in diesem Zustand?“ Ich war müde und nicht mehr zum Diskutieren aufgelegt. Deshalb erzählte ich unser Lied von der Glocke. Das hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen, denn was meine Frau dann zu uns sagte, zu mir und zu meinem Freund Ludwig, das hat sich eine Frau sicher noch zu keinem Bürgermeister und keinem Lehrer sagen trauen. Aber meine Frau hat sich getraut – und uns zwei Glockenholer gleich verurteilt. „Das ganze Geld“, bestimmte sie in ihrem untrüglichen Gerech- tigkeitssinn, „das ganze Geld, daß Ihr Euch zusammengeläutet habt, das kommt in die Kirchenkasse als Spende. Auch wenn Ihr Euch schon einen Rausch dafür gekauft habt!“
Und so ist es dann gekommen, daß im Kassenbuch von der Kirche gestanden ist: „16,80 Mark, eine Spende von Unbekannt“. Und die Unbekannten, die wirklich nur noch meine Frau gekannt hat, das waren der Bürgermeister und der Lehrer von Günthersbühl.
Der Müller, unser Zimmermann, besah unsere Glocke mit Wohlgefallen. „Die könnte in den Dachreiter hineinpassen!“ Und die Glocke passte hinein – und sie läutete dann am Kirchweih- sonntag. Wir, der Herr Dekan, die Geistlichen, die Bürgermeister und natürlich der Herr Land- rat, wir zogen nach einer kurzen Andacht vor dem Schulhaus hinauf zu unserem Kirchlein. Meine Tochter trug den Kirchenschlüssel auf einem Kissen voraus. Der Posaunenchor spielte, ich sang mit den Kindern und mit dem Gesangverein – und an der Straße standen viele Gäste aus Lauf, Neunhof und aus allen anderen umliegenden Orten.
Sie wollten alle das neue Kirchlein sehen und ihrer Freude darüber auch in klingender Münze Ausdruck geben. Als „Geldverwalter“ war ich daran besonders interessiert, denn wir hatten am Tag der Kircheneinweihung noch 5300 Mark offene Rechnungen für die Fenster und die Türen. Mit den Spenden der Kirchweihbesucher sollten wir den größten Teil dieser Schulden tilgen können. Aber 5300 Mark waren schon eine ganz schöne Summe.
Am Abend des Kirchweihtages war die Dorfstraße wieder leer, wir waren wieder unter uns. Und wir drei, der Pfarrer, der Bürgermeister und ich, der Lehrer, wir saßen wieder in unserer Küche, saßen da, wo alles einmal angefangen hatte. Auf unserem Küchentisch hatten wir die Opferbüchsen, die Beutel und die Zigarrenkistchen entleert, in denen wir tagsüber die Spenden und die Opfergaben gesammelt hatten. Es lag viel Geld auf dem Tisch. Waren es 5300 Mark?
Der Ludwig zählte die Scheine, ich das Silbergeld – und der Pfarrer in christlicher Demut nahm sich der Groschen und Pfennige an. Meine Frau, die Zuverlässige, hatte den Auftrag, die gezählten Summen zusammenzuzählen.
„Wir haben 1000 Mark“, sagte sie schon bald. Dann sagte sie: „Wir haben 2000 Mark“, dann 3000 Mark, 4000 Mark und schließlich 5000 Mark. „Weiter“ trieb uns der Ludwig ungeduldig an, „döi 300 Mark, döi 300 Mark döi packn mir aa nu!“ wir zählten weiter und kamen den 5300 Mark immer näher. Der Ludwig steckte mit seiner Aufgeregtheit sogar mich an. Plötzlich hatten wir die 5300 Mark erreicht – und es lag immer noch viel Geld auf dem Tisch.
Wir waren alle froh, nur der Pfarrer saß still da, fast wie ein Fremder in unserer Freude. „Herr Pfarrer“, sagte ich, „wir können alles bezahlen. Wir haben mehr Geld, als wir brauchen.“ Der Pfarrer schaute mich über den Rand seiner Nickelbrille fast ein wenig vorwurfsvoll an: „Geld“, sagte er dann, „geht es hier wirklich nur noch um Geld?“ Wir wurden alle still, und der Pfarrer faltete seine vom Geld schmutzigen Hände und sprach ein Dankgebet, das mit dem 23. Vers des 118. Psalm endete: „Das ist vom Herrn geschehen – und ein Wunder vor unseren Augen!“ Und alle, die wir diesen Kirchenbau miterleben durften und diesen Vers hörten, wir glaubten daran, „daß dies vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen war.“
Wir danken der Pegnitz-Zeitung für die Genehmigung dieses Nachdrucks!